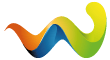Der Sonnenbeißer Amrakh
Einst trug er einen Namen, den heute nur noch ein leerer Grabstein in Amrakh-Sut kennt, eine Platte, unter der nie ein Körper lag.
Er war Goldgräber, Mitte dreißig mit kantigem Gesicht und kurzem schwarzem Haar, die muskulösen Hände voller Schwielen, die Augen rot vom Staub der Schächte, in denen er arbeitete.
In Amrakh-Sut, wo die Minen große Trichter bildeten und das Gestein so heiß war, dass es die bloßen Füße verbrannte, verweigerte ihm ein Aufseher einen Schluck Wasser. Der Schlag saß. Ein einziger Hieb mit dem Vorschlaghammer. Der Schädel des Aufsehers platzte wie eine überreife Frucht, als sie ihn schon in Ketten legten.
Dreimal wurde er zum Tode verurteilt:
In Amrakh-Sut sollte er hängen.
In Yazmar wollte man ihn vierteilen.
In Malqeshar hatte man bereits den flachen Stein bereitet, auf dem man ihn der Sonne braten würde.
Dreimal war die Hinrichtung vorbereitet, und jedes Mal sprach ein Sonnenpriester: «Alvashek will ihn lebendig.»
Und das Wort des Sonnengottes galt mehr als das Urteil eines Sterblichen.
Als die Sonne im Westen versank und der Himmel sich blutrot färbte, führte ihn der Henker von Amrakh-Sut in den tiefsten Kerker. Der Raum war klein, die Wände aus schwarzem Basalt, der die Hitze des Tages wie ein Ofen speicherte. Auf dem Kohlebecken glühte das Sonnenzeichen aus purem Gold. Der Henker sagte nichts. Er packte die Zunge mit einer Zange, zog sie weit heraus und drückte das Zeichen hinein. Das Fleisch zischte, ein Geruch von verbranntem Fleisch erfüllte den Raum. Der Schrei war kurz, dann erstickte er in Blut und Rauch.
Als die Sonne wieder aufging, war der Mann kein Mensch mehr.
Er war der Amrakhi. Der-aus-Amrakh. Oder auch nur: Amrakh.
Der seelenlose Name eines neuen Folterers.
Noch in derselben Nacht öffneten sich die Tore, nur einen Spaltbreit, gerade genug, dass ein nackter Mann hindurchpasste. Der Henker, ein alter Mann mit einem Gesicht wie ausgetrocknetes Leder, hob die lange Peitsche aus Kamelhaut. Der erste Hieb pfiff durch die Luft und riss eine feurige Linie quer über den Rücken des neuen Folterers. «Amrakhi!» brüllte die Menge, die sich auf den Mauern und im Staub davor drängte – Frauen, Kinder, Söldner, Priester –, alle mit einer Stimme, die sich anhörte wie das Heulen des Wüstenwinds.
Ein zweiter Hieb, ein dritter. Jeder Schlag trieb ihn einen Schritt weiter in die Nacht hinaus. «Amrakhi! Amrakhi!» Der Name prasselte auf ihn nieder wie glühender Hagel, während das Blut warm über seine Hüften lief.
Nackt lief er nach draußen, die frischen Peitschenschläge brannten wie flüssiges Feuer. Der leere Wasserschlauch schlug gegen seine Hüfte. Hinter ihm brüllte die Menge: «Amrakhi! Amrakhi!» – ein Chor, der sich tiefer einbrannte als das Eisen.
Die Peitsche knallte ein letztes Mal und dann traf ihn der letzte Ruf: «Amrakh, du verfluchter Amrakhi – lauf, bis Alvashek dich wieder sieht!»
Er stolperte in die Dunkelheit, barfuß, nackt, der leere Wasserschlauch klatschte gegen seine Schenkel. Die Menge verstummte, oder er konnte sie nicht mehr hören. Hinter ihm fiel das schwere Tor ins Schloss. Das Echo ihrer Stimmen hallte in seinem Kopf wieder, bis sein keuchender Atem alle Gedanken zerriss. Er rannte. Barfuß über den kalten Sand der Nacht, dann über den glühenden Sand des Tages, bis Amrakh-Sut nur noch eine Erinnerung war und der Wind ihm die Haut austrocknete. Stämmig war er und ausdauernd von der harten Arbeit, die Augen dunkelbraun mit goldenen Sprenkeln, als hätte sich das Golderz darin festgesetzt. Die meisten Folterer starben bei ihrer ersten Wanderung, doch Amrakhi hoffte, dass er es schaffen konnte, weil er stärker war als die meisten.
Vier Tage und vier Nächte irrte er durch die Tamjara. Nachts wurde die Wüste zu kalt, als dass er ruhen konnte, ohne den Tod zu riskieren, so dass er weiterlief. Tagsüber verbrannte Alvasheks Licht seine Schultern und die nackten Sohlen seiner Füße.Nur in den milden Stunden der Dämmerung fand Amrakh etwas Ruhe und Schlaf. Am fünften Tag brach er zusammen, die Zunge lag geschwollen und trocken wie ein fremdes Stück Leder in seinem Mund, die Augen schmerzten von der gleißeden Helligkeit und vom Sand. Vor ihm ragten die Sandsteinmauern von Kharidun in den Himmel. Das Tor war offen und Menschen zogen in endlosen Reihen durch das Tor. Er konnte mit der verbrannten und entzündeten Zunge nicht sprechen, um nach Hilfe zu fragen. Aber der Henker der Stadt erkannte, was hier passiert war, und wusste das Brandmal zu deuten. Ein kurzes Nicken.
Er trug Amrakh durch ein kleines Seitentor, legte ihn im Schatten eines Gewölbes auf eine Strohmatte und flößte ihm lauwarmes Wasser ein. Drei Wochen durfte Amrakhi bleiben, um sich zu erholen. In dieser Zeit zeigte der Alte ihm die ersten Spiegel, kleine, handtellergroße Scheiben aus poliertem Blech, die Alvasheks Strahlen zu einem nadelfeinen Strich aus Licht bündeln konnten. «Alvashek ist geduldig», sagte der Henker. «Er wartet immer.» Er schenkte dem Amrakhi den Spiegel, den er fortan an einem Lederband um den Oberkörper trug, und einfache Kleidung.
Dann war die Zeit um. Der Henker hatte keinen Platz für einen weiteren Folterer. Amrakh musste wieder hinaus in die Glut. Diesmal nicht mehr nackt, nicht mehr mit leerem Schlauch. So zog er von Ort zu Ort, bis er einen Henker fand, der ihn nicht fortschickte, sondern zu seinem Folterer machte. Jahre vergingen und Amrakh lernte. Er konnte kaum noch sprechen, doch er redete in der Sprache des Schmerzes und konnte nach all seinen Wanderungen die Wüste lesen wie ein Buch: wo der Wind am schärfsten schnitt, wo die Oasen nur Trugbilder waren, wo man nachts Schutz fand zwischen den Chitinrippen eines verendeten Riesenwurms. Die Wüste hatte ihn gequält, sie quälte jeden. Sie war das vollkommene Folterinstrument, und Amrakh, der verfluchte Amrakhi, bediente sich am liebsten der gebündelten Hitze des Sonnenlichts.
Er lernte, dass ein Mensch länger schreit, wenn man ihm die Augen nicht sofort ausbrennt, sondern nur die Hornhaut langsam zum Kochen bringt, Millimeter für Millimeter, bis die Welt für noch aus weißem Feuer besteht. Er lernte, dass der Henker überall der Einzige bleibt, der einem Verbannten die Tür öffnet, Suppe kocht, die Wunden verbindet und einen irgendwann wieder hinausjagt, nicht aus Grausamkeit, sondern weil die Wüste keine bleibenden Folterer duldet. Wann immer er meinte, dass der neue Ort Heimat geworden ist für den Amrakhi, so musste er gehen. Manchmal nach Tagen, manchmal nach Jahren. Und einmal auch, weil ein neuer Folterer vor den Toren auftachte, der die Hilfe des Henkers nötiger brauchte als Amrakh.
Heute kennt man den Goldgräber, der gemordet hatte und die Gnade des Sonnengottes erfuhr, den Folterer aus Amrakh-Sut, nur noch als den Sonnenbeißer Amrakh. In seiner einstigen Heimat spricht niemand mehr seinen alten Namen aus und in den Orten, in denen er foltert, kennt man ihn nur unter seinem Namen als Werkzeug des Henkers. Seine Spiegel sind zahlreich geworden und sie alle sind aus poliertem Blech, manche mannsgroß auf Dreibeinen, andere klein wie eine Münze, die er in der Hand hält. Er bindet sein Opfer auf den flachen Stein, so wie es ihm einst selbst bestimmt ward, richtet die Spiegel aus und wartet.
Alvashek tut den Rest.
Amrakh wartet geduldig, denn auch Alvashek ist geduldig.
Und wenn das Geständnis endlich aus dem Mund des Opfers quillt, so wie die gekochten Augen aus den Höhlen, dann lächelt der Amrakhi, ein Lächeln, das niemand sieht und das niemand je wieder sehen wird.
Manchmal, in den langen Nächten, wenn er wieder wandern muss und wieder im Sand liegt, den Blick zu den kalten Sternen gerichtet, fühlt er das eigene Narbengewebe auf der Zunge. Die eingebrannte Sonne. Er schmeckt Alvasheks Mal. Er ist genau dort, wo Alvashek ihn haben wollte. Amrakh, der Folterer aus Amrakh-Sut, der Amrakhi. Und irgendwo, weit hinter dem Horizont, wartet noch immer ein lehres Grab, das er niemals benutzen wird, denn für einen Folterer gibt es eigene Bestattungsriten, und die Rückkehr in die alte Heimat gewährt das Gesetz ihm nicht einmal im Tod.