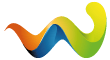Anmerkung: rot markierter Text bestand schon vor dem NaNo
Prolog
Linu nahm Anlauf und rannte auf das Ende der Klippe zu, die 100 m senkrecht nach unten bis zum Meer reichte. Das Gras war weich und grün und umschmeichelte ihre nackten Füße. Am Abgrund angekommen sprang sie ab und schneller als man Blinzeln konnte, hatte sie sich verwandelt. Elegant schwebte sie mit weit ausgespannten Schwingen in den blauen Himmel und stieß dabei ein Jubelkreischen aus.
Zwei Meter mindestens mochte die Spannweite der Schwingen auf dem Gemälde hinter Lord Xyrius Tisch betragen. Triborin betrachtete das Bild, während er wartete. Noch nie hatte er einen derart großen Vogel gesehen. Das Gefieder war braun, doch an den Spitzen leuchtete es golden und um den kräftigen Leib trug das Wesen einen hölzernen Harnisch.
„Hallo Triborin.“ Er zuckte zusammen. Xyrius hatte absolut lautlos den Raum betreten.
„Lord Xyrius“, Triborin verbeugte sich.
„Du musst etwas für mich tun.“
Rak packte sich mürrisch eine Armladung Holzscheite und ging zum großen Ofen der Bäckerei. Wie ihm geheißen, warf er eins nach dem anderen in die knisternden Flammen.
„Rak mach dies, Rak mach das“, grummelte er vor sich hin. „Dabei sollte ich ein Krieger sein! Ja ein Krieger, wie zu Zeiten der großen Schlacht!“
Er schwang eines der Holzscheite wie ein Schwert zur Seite.
„Sterbt, ihr Ratten!“
„Sonst, verehrte Dame, verehrte Herren, werden wir alle sterben“, beendete der Lord der Alben unterdessen in der Kühle seines Ratsaales eine lang geplante Rede.
Sinklar beobachtete die Wirkung seiner Worte im großen Saal. Oh ja, er war ein guter Redner, schon immer. Diese Eigenschaft war nicht unentscheidend gewesen bei seinem Aufstieg auf den Thron von Mildir. Da saßen sie nun, die Herrscher und Berater der umliegenden Reiche, träge und eingerostet durch den langen Frieden und lauschten seinen Worten. Hatten die Alben nicht schon lange davor gewarnt, dass Rebellionen entstehen würden? Das hatten sie, mehrfach. Doch Menschen- und Zwergenohren konnten so fürchterlich taub sein, wenn sie von Wein und Wohlstand umgeben waren. Dass die Stühle von Lord Xyrius und seinem Gefolge ebenso leer geblieben waren, wie die von König Warkas, musste nun aber wirklich jedem aufgefallen sein und machte die Lage in Orchaldor nicht besser.
Kaiserin Limargre erhob sich anmutig von ihrem Platz.
„Ihr sprecht sehr schwarz, Euer Ehren. Wo sind die Beweise für den aufziehenden Sturm?“
Menschliche Skepsis, dachte Sinklar. Die dunkle Schönheit aus dem Süden sprach an, was vermutlich alle dachten.
„Wir sehen seit einiger Zeit Veränderungen in der Natur, die Bäume wissen es, Mylady. Außerdem erreicht uns zunehmend die Kunde über Raubzüge; auch jenseits der Grenzen Mildirs“, fügte er an. „Ich denke, dass die Wilden sich scharen. Doch wer führt sie?“ Er ließ seinen Blick bedeutend über die leeren Plätze schweifen.
„Ihr glaubt, dass Xyrius und Warkas gemeinsame Sache machen?“
Bromir, der Zwerg blickte ihn fordernd an. „Die beiden können sich nicht ausstehen.“
„Nein, mein lieber Bromir, das glaube ich nicht. Ich denke, dass einer von beiden etwas im Schilde führt und der andere aus anderen Gründen fehlt. Ich habe beiden nie vertraut.“
Die Herrscher sahen sich unter einander an. Jeder wusste um der Alben Rivalität mit den Dunkelelfen und ebenso deren Ablehnung gegen das raue Menschenvolk aus Nordost.
„Verzeiht mein Bedenken, aber zieht Ihr womöglich voreilige Schlüsse, was die Abwesenheit der beiden betrifft? Xyrius hat schon immer gerne sein eigenes Süppchen gekocht und lässt jeden gerne spüren, dass er nur das tut, was er will und wann er es will. Und Warkas… es gibt Gerüchte, dass er nicht mehr bei Sinnen ist.“
„Und widerspricht eines von beiden meinen Befürchtungen?“
Er wandte sich wieder der ganzen Runde zu.
„Wie ich zu Beginn bereits sagte, liebe Freunde, es ist im Augenblick unerheblich, wer unser Feind ist. Wir müssen uns nur einig sein, dass es einen Feind gibt. Seid wachsam, schickt Späher und Spione aus, sammelt und formiert Eure Truppen und überprüft Eure Verteidigungsanlagen. Macht Euch bereit, anderen zur Hilfe zu eilen.“
Nachdem er seine Stimme stetig hatte anschwellen lassen, pausierte er kurz, bevor er gewichtig anfügte: „Ich werde unterdessen nach den Aviaren schicken.“
Sofort setzte Gemurmel ein am Tisch. Bromir erhob als erster die Stimme. „Bei allem Respekt, Lord Sinklar, die Aviaren sind seit der großen Schlacht Malgors ausgestorben.“
„Das weiß niemand“, warf Limargre ein. „Legenden besagen, dass sie geflohen sind.“
„Das Vogelvolk ist selbst nur mehr eine Legende“, beharrte Bromir. „Niemand weiß, was mit ihnen geschah. Heutzutage weiß kaum jemand mehr, dass sie überhaupt je existiert haben. Sogar die Relikte und Erinnerungen an sie sind komplett in Vergessenheit geraten. Wie kommt Ihr darauf, dass diese Suche lohnt? Was wisst Ihr, was wir nicht wissen, Lord Sinklar?“
„Ich glaube daran, mein lieber Bromir. Und lasst dieses Unternehmen ganz meine Sorge sein. Ich denke, Ihr habt genug Dinge, um die Ihr Euch selbst kümmern müsst.“
Bromir schnalzte mit der Zunge. „Ich habe mein Reich durchaus besser im Griff als Ihr vielleicht meint. Und auf gar keinen Fall, werde ich das Volk unnötig in Aufruhr bringen, indem ich überall Truppen stationiere. Meine Burgen sind intakt, meine Männer tapfer und stark.“
„Das könnt Ihr gewiss besser beurteilen als ich, mein Freund. Alles was ich kann, ist euch zu warnen. Ein Sturm zieht auf.“
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Linu
Was für ein wundervoller Tag! Linu war mit ihrem Freund Taal so lange auf den umliegenden Wiesen unterwegs gewesen, bis die eigene Hand vor Augen kaum mehr zu erkennen war, so stark hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Natürlich war Aalon nicht glücklich darüber. Ihr strenger Vater hatte die junge Aviare schon an der Tür ihrer kleinen Hütte mit einer Standpauke erwartet. Dabei war es momentan so mild, die Wiesen so grün und üppig und überall duftete es lieblich. Auch die Ernte war großzügiger ausgefallen als je zuvor, zumindest so lange Linu sich erinnern konnte. Großmutter Sonila hatte ganze Regale mit wunderbaren süßen Cremes, Säften und Trockenfrüchten gefüllt, um die Gaben der Natur verarbeiten zu können. Und trotzdem rügte Aalon seine Tochter, die seine Strenge nicht verstehen konnte. Die Füchse und Baumkatzen kamen nie so weit in die Ebene hinaus und sie wusste nicht, was ihr sonst hätte gefährlich werden können. Im Gegenteil: am liebsten hätte Linu die ganze Insel erkundet, den großen Wald und das Gebirge und anschließend auch all die anderen Inseln von Caertol. Großvater Min erzählte von mehr als zwanzig größeren und kleineren Inseln, die sich teilweise so steil und schlank in den Himmel streckten, dass man oben gerade einmal Platz zum stehen hatte. Nicht wenige Male hatte sie den Wunsch bereits geäußert, doch Aalon erlaubte es ihr nicht.
„Du bist zu jung“, sagte er stets. „Du könntest dich verirren, deine Kraft überschätzen oder angegriffen werden.“
Eines Tages würden sie einen Schulausflug machen, versicherte er ihr, doch Linu wollte ihre Umgebung jetzt erkunden. Sie war 13 und sehnte sich nach einem Abenteuer.
Der Alltag in dem kleinen Dorf war zäh wie Sirup, jeder Tag wieder der andere. Früh morgens half sie Mutter und Vater dabei, die Hühner zu füttern oder deren Gehege zu reinigen und anschließend war Schule. Immerhin konnte sie dort ihre Freunde sehen, Taal und Flinn, die beiden Jungen mit denen sie so gerne spielte. Am schulfreien Ralonstag stand stets der Hausputz an. Die großen, von vielen Füßen glatt polierten Steinfliesen wurden gekehrt und gewischt, die Kochstelle und der Kamin vom Ruß und die Hauswand so gut es ging vom Salz befreit, dass der Wind konTriborinuierlich über die Ebenen von Caeron blies, der Insel, auf der sie lebten. Aber nie geschah etwas Besonderes, nichts, dass nur annähernd so interessant und magisch gewesen wäre, wie Großvater Mins Geschichten.
Min war nicht Linus echter Großvater. Ein jeder nannte ihn so, da er mit Abstand der älteste Aviare im Ort war und auch in allen Nachbarorten, soweit Linu wusste. Er hatte immer eine Geschichte für die jungen Aviarenkinder parat, die ihm neugierig an den Lippen hingen. Es gab Unterwasserwelten versunkener Städte und ferne KonTriborinente mit magischen Feen und tapferen Helden. Doch auch von Caertol erzählte der alte Mann; von mystischen Geheimnissen in den Tiefen des Attalongebirges und des umliegenden Waldes, von Begegnungen mit den dort lebenden Menschenaffen, von Exkursionen auf andere Teile der Inselgruppe und von mutigen Aviaren, die Abenteuer suchten und siegreich nach Hause kehrten. Konnte das Leben in Wirklichkeit nur aus Hausarbeit und der Dorfgemeinschaft bestehen?
Tags darauf kamen Linu und Taal vom Reisig Sammeln zurück ins Dorf, als sie eine große Menschentraube vor einer der Hütten bemerkten. Die ganze Gemeinde schien sich dort aufzuhalten, denn sowohl der kleine Marktplatz als auch die Freiluftkapelle – Orte, an denen tagsüber stets ein reges Treiben herrschte – waren wie leergefegt. Es war Großvater Mins Hütte. Linu schmiss ihre Zweige in den Speicher und rannte auf die Gruppe zu.
„Was ist los?“
„Großvater Min liegt im Sterben. Er wird bald übertreten und er richtet gerade seine letzten Worte an einige aus dem Clan“, flüsterte ihr Flinn zu. Linus Augen weiteten sich. Natürlich hatte sie damit gerechnet. Es war nur eine Frage der Zeit gewesen und trotzdem fühlte sie sich in diesem Augenblick gänzlich unvorbereitet und hilflos.
„Darf ich zu ihm?“, fragte sie Pater Ren mit einem Zittern in der Stimme.
Der Geistliche nickte und schwer schluckend trat die junge Aviare in Großvater Mins Hütte ein. Er war dunkel und stickig und die Luft war übersättigt vom Geruch verschiedenster Heilkräuter und von Schnaps.
„Ah, Linu mein Kind“, sagte Min mit brüchiger Stimme und hob dabei kaum den Kopf. „Komm her zu mir, damit ich nicht so schreien muss.“
Linu trat ans Bett und legte ihre Hände auf den Matratzenrand. „Du stirbst?“
„Nein meine Kleine, ich sterbe nicht. Ich bin jetzt bereit, um weiter zu ziehen. Der Pater hat Ralon befragt; er nimmt mich auf in die ewigen Himmel.“
„Aber du bist dann nicht mehr hier.“
„Mein Körper nicht, nein, aber mein Geist wird immer über euch wachen und wenn ihr zu Ralon betet, werde ich es auch hören.“
Er hustete und trank einen Schluck.
„Erinnerst du dich an meine Geschichten?“
„Aber ja! An jede einzelne“, rief Linu aus und Min lächelte schwach.
„Ich habe dir viel erzählt, seit du noch ganz klein warst und ich habe das nicht nur getan, weil ich ein guter Erzähler bin. Es gibt Dinge, die verloren gegangen sind, Wissen und Fertigkeit und mein ganzes Leben habe ich daran geforscht. Du musst wissen, dass Caertol nicht das einzige Stückchen Land auf diesem Planeten ist. Es ist sogar nur ein winzig kleiner Teil. Und ich habe Grund zu der Annahme, dass wir nicht von hier stammen.“
„Was?“ platzte Linu heraus. „Davon hast du mir noch nie erzählt!“
„Doch mein Kind, das habe ich. Versuche dich an meine Geschichten zu erinnern. Alles was ich weiß, habe ich dort verarbeitet, denn es gibt Aviaren unter uns, die meinen Forschungen schon immer kritisch entgegen standen. Dabei ist es so wichtig. Es wird …“ Er hustete erneut, dieses Mal kräftiger. „Es wird eine Zeit geben, in der man sich auch anderorts wieder an uns erinnert und dann müssen wir bereit sein.“
„Ich verstehe gar nichts“, seufzte Linu.
„Das wirst du! Auch wenn die Zeit jetzt knapp ist und ich dir nicht so viel erzählen kann, wie ich mir gewünscht hätte. Ich dachte immer, du bist noch zu jung, doch jetzt stellt sich heraus, dass ich zu alt bin.“ Er lächelte. „Denk an meine Geschichten, wenn dir wirklich etwas daran liegt, meine Forschungen weiterzutreiben. Ich glaube, du bist dazu bestimmt. Und jetzt geh, mein Kind, ich muss noch mit Maad sprechen.“
Linu wusste, dass er ihr keine weiteren Fragen beantworten würde, dafür kannte sie den alten Mann zu gut. In Gedanken versunken verließ sie die dunkle Hütte und ging zurück zu Taal und Flinn.
„Was wollte er?“
„Ich bin nicht sicher. Er hat irgendetwas von anderen Ländern erzählt und dass irgendwer sich an uns erinnern wird.“ Sie blickte ihre beiden Freunde an und seufzte. „Ich kann nicht glauben, dass er bald nicht mehr da ist.“
Welche Informationen sollten die Geschichten enthalten? Großvater Min hatte schon immer gerne in Rätseln gesprochen. Ihre Mutter meinte, dass liege an seinem Alter. Er war der beste Geschichtenerzähler gewesen, doch in diesem Augenblick war die junge Aviare sich nicht mehr sicher, ob es wirklich Geschichten waren. Sie spürte Wut und Trauer, dass sie ihn das alles jetzt nicht mehr würde fragen können.
Später am Abend saß sie bei Tisch mit ihren Eltern.
„Papa“, setzte sie schließlich an, nachdem sie seit einiger Zeit schon unentschlossen in ihrem Essen herumgestochert hatte. „Min hat mir heute gesagt, dass Caertol nicht der einzige Ort auf dieser Welt ist.“
Ihr Vater sah sie mit seinen strengen gelblich-braunen Augen eindringlich an. Dann antwortete er.
„Den Legenden zufolge – und niemand weiß, ob es reine Märchengeschichten sind – gibt es im Norden einen großen KonTriborinent, der unsere Heimat wie winzige Kleckse im Meer erscheinen lässt.“
„Wieso hast du mit nie davon erzählt?“
„Weil es Legenden sind, Linu. Was nutzt dir dieses Wissen?“
Linu sagte nichts. Vater hatte natürlich recht, es hätte ihr nichts genutzt, bis jetzt zumindest. Jetzt war sie gezwungen darüber nachzudenken, wenn die Worte Mins nicht nur das wirre Gerede eines sterbenden Mannes gewesen waren.
„Und was weißt du von diesem KonTriborinent?“
„Nicht viel.“ Aalon seufzte. „Den Legenden nach gibt es dort viele verschiedene Völker, ganz anders als wir und anderes Wetter und anderes Land.“
„Und kommen wir von dort?“
„Was?“ Ihr Vater stoppte den Löffel auf halben Weg zum Mund.
„Min hat gesagt, wir sind nicht von hier. Kommen wir dann von dort?“
„Min hat wahrlich schon wieder zu viele Geschichten erzählt. Ich weiß von keinem Aviaren, der nicht auf Caertol geboren wurde und jetzt iss deine Suppe!“
Linu schlief in dieser Nacht lange nicht ein und als sie es tat, träumte sie von angreifenden Menschenaffen und vom hustenden Min.
Am nächsten Tag beschloss sie, auf Erkundungsflug zu gehen. Sie sprang von der Klippe und flog in eleganten Pirouetten in den Himmel hinauf. Dann steuerte sie mit kräftigen Flügelschlägen hinaus auf das Meer. Es veränderte sich. An den Klippen und Stränden von Caertol war es hell und blau, doch schon nach wenigen Minuten wurde es dunkel und sah kalt aus. Es war unruhig und wild, nicht so stetig und vorhersehbar wie sie es kannte. Sie blickte zurück. Die einzelnen Inseln Caertols waren nur noch dunkle Flecken inmitten des endlosen Blaus. In allen anderen Richtungen gab es nichts bis auf den Horizont. Linu flog weiter. Nach einer halben Stunde konnte sie Caertol nicht mehr sehen und ihre Flügel schmerzten. Das Mädchen begann sich zu fürchten. Sie verharrte kurz in der Luft, dann drehte sie um. Sie musste sich ausruhen.
Es war gerade rechtzeitig gewesen: mit letzter Kraft erreichte sie die erste Insel, landete am Strand und sank erschöpft zu Boden. Sie nahm ihre Menschengestalt an und lehnte sich rücklings an die steil aufsteigende Felswand. Sie atmete schwer.
„Wo soll es hier Land geben?“ dachte sie. Vielleicht war Min doch nur ein alter verwirrter Mann gewesen.
Rak
Rak war früh morgens auf den Beinen, lange bevor die feinen Leute im Palas der Festungsanlage von ihren Dienern geweckt, mit einem Bad und Frühstück versorgt und frisch eingekleidet würden. Noch bevor es richtig hell war, holte er die Leiber aus dem Ofen, die die ganze Backstube mit dem Duft von warmem Roggenbrot erfüllten. Er legte sie einzeln zum Abkühlen auf den Holzrost und bestäubte sie mit etwas Mehl. Dann, mit Anbruch des Tages, kamen die Mägde und Köche der verschiedenen Höfe und aus der Burg, um das frische Brot abzuholen. Rak nahm die Münzen entgegen und brachte sie seinem Vater.
„Alle verkauft“, sagte er.
„Gut“, antwortete Brigg. „Geh zur Mühle, ich komme gleich nach.“
Rak tat wie ihm geheißen. Unterwegs schnappte er sich eine Flasche Dinkelbier, öffnete sie mit den Zähnen und trank einen großen Schluck. Er stellte die Flasche in eines der Regale und warf sich einen Sack Roggenkörner über die Schulter. Fünf Säcke brachte er zur Mühle und begann, den Trichter zu füllen. Dann kam Brigg dazu und setzte die großen Mahlsteine in Gang. Rak nahm oben auf dem Holzgerüst Platz und trank nach und nach das Bier, darauf bedacht, dass sein Vater ihn von unten nicht dabei sah. Von Zeit zu Zeit füllte er Körner nach, bis Brigg ihm signalisierte, dass es genug sei.
Rak brachte die Flasche zurück und ging zum Holzschuppen. Eine seiner Aufgaben war sicherzustellen, dass jederzeit genug gehacktes Holz aufgestapelt war, um nicht nur die Öfen der Backstube sondern auch den großen Kamin im Wohnhaus befeuern zu können. Es war noch genug vorhanden, also kehrte er zurück zur Backstube.
„Vater“, setzte er an, „darf ich zum Ritterturnier gehen?“
Brigg sah vom Teigkneten auf. Das Mehl ließ sein Haar noch grauer aussehen, als es eh schon wurde und unter den kastanienbraunen Augen, die er auch seinem Sohn vererbt hatte, bildeten sich deutliche Falten.
„Ist genug Holz im Speicher?“
„Ja, Vater, es ist bis zur zweiten Ebene gefüllt. Ich habe gerade nachgesehen.“
„Und Lise und Nele, haben sie noch Heu?“
„Ich bringe ihnen etwas! Darf ich dann gehen?“
„Einverstanden, Rak. Aber komm nicht zu spät heim und lass dir nichts von Fremden aufschwatzen.“
„Danke, Vater! Ich werde auf jeden Fall vorsichtig sein!“, rief er aus und rannte aus der Bäckerei.
Als Rak an der Turnierwiese ankam, war der Wettkampf bereits im Gange und er drängelte sich durch die Menge, um etwas sehen zu können. Mittlerweile war Rak schon 15, doch er hatte nichts von seiner Faszination für Ritter verloren. Die Schlachtrosse, die Rüstungen und vor allem die Schwerter brachten sein Gesicht zum Strahlen. Für den jungen Bäckersohn verkörperte ein Ritter Edelmut und Stärke, ein Leben für den Kampf, für einen hohen Herren oder mit etwas Glück vielleicht auch eine hohe Lady, die man bedingungslos beschützte. Die Männer mussten Nerven wie Drahtseile haben und Muskeln wie Stein, dachte Rak Gebannt beobachtete er, wie sich zwei Ritter auf den gegenüberliegenden Seiten des Feldes postierten, um sogleich aufeinander zu zu galoppieren und sich die Lanzen gegen die Brust zu hämmern. Er selber war auch schon stark. Er konnte bereits alleine einen ganzen Sack Körner zur Mühle hieven und die Schubkarre machte er schon so voll mit Mist wie sein Vater. Unter dem rhythmischen und dumpfen Takt der Pferdehufe stellte sich der Junge vor, er säße auf einem der Rösser und ganz unwillkürlich spannte er seine Schulter an, um zum Stoß anzusetzen … Es schepperte laut und einer der Männer fiel zu Boden. Die Menge jubelte und unter ihnen Rak, als hätte er selbst den Kampf gewonnen.
„Sieh an, da ist ja das Brötchen“, ertönte eine Stimme von rechts.
Rak stoppte seinen Jubel und blickte in das Gesicht der rothaarigen Cousine des Prinzen. „Wie kommt es, dass du heute hier bist? Backt sich das Brot von alleine?“
„Ich bin heute schon fertig mit der Arbeit“, sagte Rak.
„Und da verschwendest du deine Zeit auf dem langweiligen Ritterturnier? Matthes hat Bier geklaut. Du könntest mit uns zum Fluss kommen.“
„Ich schaue mir gerne Ritterturniere an“, erwiderte der Bäckerjunge.
„Klar machst du das. Es ist sicher nicht so langweilig wie Brötchen backen.“
„Wenigstens arbeite ich.“
„Hüte deine Zunge! Ich könnte dich mit einem Wink meiner Hand auspeitschen lassen.“
Rak folgte ihrem Kopfnicken und erblickte in nicht allzu großer Entfernung Sir Kartoff, der ihr Gespräch ohne auch nur zu Blinzeln verfolgte.
„Traust du dich auch ohne ihn auf die Straße?“
Sara seufzte. „Meine Mutter lässt mich nicht ohne ihn auf die Straße. Was ist nun, kommst du mit?“
Rak blickte zur Arena. Eigentlich wollte er lieber hier bleiben. Doch wie wirkte das vor den anderen Jugendlichen, wenn er sich wie ein kleiner Junge lieber ein Ritterturnier ansah?
Er folgte Sara durch die Menge in Richtung des Flusses. Der Dimmort war kein großer Strom, führte aber doch genug Wasser, um die Zisternen der Burganlage zu speisen, die sich erhaben und mächtig in Mitten der Senke auf einem zu drei Seiten steil abfallenden Hügel erhob. Das kreisrunde Tal wurde von dichten Nadelwäldern gesäumt und bot nur je einen ebenen Zugang zu beiden Seiten, die auch der Fluss nahm.
In Zeiten von Krieg und Belagerungen war Burg Kalkstein der sichere Zufluchtsort für die Menschen aus dem Umland. Natürlich hatte es schon lange keine Schlacht mehr gegeben, doch Rak hatte davon gehört und auch von den tapferen Rittern des Königs, die stolz zu Pferd ihren Herren und ihr Land verteidigten.
Die Bäckerei und das Wohnhaus seiner Eltern lagen innerhalb des ersten Mauerringes und häufig erklomm er die Wehrgänge und blickte in die Ferne, sah die Herden der Viehhirten und die Felder der Bauern. Er würde keiner der ihren werden, kein Hirte, kein Bauer und auch kein Bäcker, das schwor sich Rak jede Nacht vor dem Einschlafen. Er würde sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und etwas aus seinem Leben machen. Wie beneidete er die jungen Leute aus dem Palas. Der einzige Unterschied zwischen ihnen war die Familie, in der sie geboren waren und während er Tag für Tag schuftete, genossen sie jeden erdenklichen Luxus mit eigenen Dienern, die ihnen jeden Wunsch von den Lippen ablasen.
Am Fluss war nicht nur Matthes, der Knappe, sondern auch drei andere Jungen aus dem Dorf und, wie Rak erstaunt feststellte, die Prinzessin höchst selbst.
„Was starrst du so?“, fuhr sie Rak an. „Im Gegensatz zu meinem hohen Bruder vermisst meine Anwesenheit bei so einem Schwachsinn wie diesen Turnieren niemand. Da kann ich genauso gut ein wenig Spaß haben.“
Rak blickte sich um und lange suchen musste er nicht: am Rande der Böschung waren drei Ritter der königlichen Garde postiert. Er fragte sich, ob es Fluch oder Segen war, immer von einer schweigenden Horde Ritter flankiert zu werden.
„Warum hast du ihn mitgebracht?“ Prinzessin Karla gab sich nicht einmal Mühe leise zu sprechen.
„Wieso nicht?“, antwortete Sara. „Desto mehr Jungs aus dem Dorf, desto besser oder nicht? So können wir uns den besten aussuchen und wenn sie uns erwischen, haben wir genug Schuldige für den Bierdiebstahl.“ Sie zwinkerte Rak zu.
Rak mochte Sara. Sie war eigentlich immer nett zu ihm gewesen, auf ihre eigene, stichelnde Art und Weise. Klara hingegen war hochnäsig und gebieterisch. Raks Vater sagte immer, sie komme nach der Königin, denn König Warkas war eigentlich immer schon ein ruhiger, gerechter Herrscher gewesen. Zumindest bis seine Frau sich vom höchsten Turm seiner Burg gestürzt hatte. Seither ließ Warkas hauptsächlich seinen Rat regieren und verschanzte sich fast rund um die Uhr in seiner privaten Kemenate. „Es ist der junge Prinz, in den das Dorf sein Vertrauen legt“, sagte Brigg immer. „Und mit ihm wahrscheinlich ganz Norgond.“
Wenn sie nicht so eine unangenehme Art gehabt hätte, hätte Klara Rak wahrscheinlich sogar leidgetan. Mit ziemlicher Sicherheit würde sie strategisch klug verheiratet werden. Wäre die Königin noch am Leben, wäre dies bestimmt schon gesehen. Mit 14 war eine Prinzessin selten noch ledig.
Die Gruppe saß am Flussufer und trank Bier. Klara hatte ihren Kopf auf Jaspers Schoß gelegt, der seinem selbstzufriedenen Gesichtsausdruck zum Trotz verkrampft und regungslos da saß. Rak verstand sich eigentlich gut mit dem Sohn des Waffenschmieds, doch es störte ihn, dass der Freund sich von der Prinzessin so manipulieren ließ. Ihm musste doch klar sein, dass für ihn nichts als Ärger aus so einer Verbindung herausspringen würde.
„Hört ihr das auch?“, sagte Matthes plötzlich in die Stille. „Hier summt etwas.“
„Du summst“, lachte Bastian. „Du hast wohl schon zu viel Bier getrunken.“
„Eben, das kommt bestimmt nur aus der Imkerei“, ergänzte Sara.
„Nein. Ich höre es auch. Das sind keine Bienen.“ Rak wusste genau, wie sich Bienen anhörten, da sich auch seine Eltern ein paar kleinere Stöcke hielten. Sie brauchten den Honig zum Süßen und das Wachs für Kerzen zu feierlichen Anlässen. Die kleinen Insekten summten auf eine stetige und sanfte Weise, doch dieses Geräusch war scharf wie eine Schneide und unstetig.
„Es kommt von hier drüben“, sagte Matthes und ging in Richtung einer dichteren Böschung. „Hier ist es richtig laut.“
Rak stand auf und folgte dem Knappen. Er hatte Recht: das Geräusch schwoll an und pochte in dröhnenden Wellen in seinem Kopf. Rak spürte ein Kribbeln in seinen Händen. Er konnte das Geräusch nicht länger nur hören, sondern auch fühlen. In Wellen strich es über seine Haut und pulsierte durch sein Blut. InsTriborinktiv hielt er sich die Ohren zu.
„Da ist etwas in dem Gebüsch“, sagte Matthes, dem das Summen offenbar weniger zusetzte. „Lass uns nachsehen, was es ist.“
Rak wollte protestieren, doch er war wie betäubt und Matthes griff bereits zum Griff seines Kurzschwerts.
Triborin
Triborin gab seinem schwarzen Ross die Sporen. Lord Xyrius hatte ihn auserwählt diese wichtige Aufgabe zu erfüllen und er würde ihn nicht enttäuschen. Er ritt bereits seit zwei Tagen und machte nur zum Schlafen Halt. Er nutzte dabei wann immer möglich die Pflicht der Bürger, einem höher gestellten Dunkelelfen Gastfreundschaft zu gewähren. Unter freiem Himmel würde er noch früh genug schlafen müssen, wenn er Lacharys verließ. Er schoss vorbei an den dichten Fichtenwäldern, in denen er als Kind so oft gespielt hatte, entlang des Filthri, der sein Bett über all die Jahre nach Belieben geformt hatte, immer in Richtung Süden. Sein blonder Zopf wehte hinter ihm im Wind und hob sich deutlich vom restlichen Erscheinungsbild ab: gemäß seines Standes war er komplett in schwarzes Leder gekleidet. Das Krummschwert steckte griffbereit im Geschirr auf seinem Rücken und an seinem Handgelenk war kaum sichtbar die kleine Armbrust mit einem Speicher voller tödlicher Giftpfeile befestigt. Triborin war weitaus gefährlicher als sein schönes Gesicht verriet.
Lord Xyrius hatte ihn auserwählt. Von all den jungen Männern aus der Akademie. Die Jahre des Schuftens hatten sich gelohnt, die Trennung von der Familie und der Verzicht auf seine Jugend. Nun, mit 20, war er ein fertig ausgebildeter Soldat der Leibgarde des Hauses Xyrius in der Festung Xarchavas und führte seinen ersten großen Auftrag aus.
Bis zur Grenze waren es zehn Tagesritte, dann würde er sich westlich halten, um Lord Xyrius‘ Wunsch nachzukommen, Mildir zu umgehen. In Vesperion musste er aber ebenso achtsam sein: König Krinkar war wie ein Schoßhündchen von Lord Sinklar. Triborin schätzte, dass er Vesperion in zwei Wochen durchquert haben würde, wenn er sich sputete. Und sobald er dann im südlichen Kaiserreich war, würde es wieder einfacher werden. Dort könnte er wieder mit einem festen Dach über dem Kopf schlafen und man sagte, dass es nirgends so gute Tavernen gab, wie in Solterra. Das Klima schenkte ihnen Weine mit voluminösen Körpern und Frauen mit kupferfarbener warmer Haut, die nach Gewürzen und Honig roch. Andererseits durfte er sich auch nicht zu sehr ablenken lassen. Xyrius hatte ihm wie immer nur das nötigste an Information für den Auftrag gegeben, aber eines hatte er mehrfach wiederholt und betont: Zeit. Je schneller Triborin seine Aufgabe erfüllte, desto besser.
Er hatte geplant sein heutiges Nachtlager in der kleinen Stadt Kaachor an der Südgrenze des Fichtenwaldes aufzuschlagen und er wusste, dass sie mit Einbruch der Dunkelheit die Tore schließen würden. Deshalb beschleunigte er sein Pferd nochmals und donnerte an zwei Getreidewägen vorbei.
Kaachor war zwar klein, dafür aber ein bedeutender Stützpunkt in Lacharys und so alt wie die Hauptstadt selbst. Der Minister von Kaachor, so sagte man, wurde immer direkt vom Lord bestimmt und nicht wie in den anderen Städten vom jeweiligen Stadtrat gewählt. Im Gegensatz zu Xarchavas war Kaachor hauptsächlich aus Holz gebaut. Das Gebirge mit seinen dunklen Steinen lag in zu großer Ferne, um das schwere Baumaterial heranzuschaffen. Triborin war noch nie zuvor dort gewesen. Er saß ab und führte sein Ross durch die recht engen Straßen der Kleinstadt. Die ausladenden Verandas im ersten Stockwerk der Häuser ließen alles noch dunkler erscheinen und gaben einem das Gefühl, durch einen Tunnel zu laufen. In einigen Wohnungen brannte Licht, doch nirgends im Erdgeschoss, wo sich wahrscheinlich, so dachte Triborin, die Nutzflächen befanden. Neugierig sog der junge Elf alles in sich auf. Er hatte schon lange darauf gebrannt, Kaachor zu besuchen. Die Stadt war nicht nur die südlichste Stadt Lacharys‘ und damit die nächste Anlaufstelle für Kunde aus dem Süden, vor allem aus Mildir, sie war auch Heimat der Schattenakademie. Nach der Leibgarde des Lords, war diese Institution das zweite Juwel der Dunkelelfischen Gesellschaft. In den verschachtelten Räumen der Akademie wurden die Meisterspione ausgebildet, die Schattengänger. Triborin hatte noch nie einen der ihren getroffen, auch wenn er bestimmt schon öfter in der Nähe gewesen war. Wenn ein Schattengänger nicht gesehen werden wollte, wurde er nicht gesehen. Und mit Sicherheit hatte Lord Xyrius eine ganze Horde des Geheimdienstes in seiner Festung stationiert. Vorfreude paarte sich mit dem kleinen Funken Hoffnung in Triborin, in ihrer Heimatstadt endlich einmal einen Spion zu Gesicht zu bekommen, und wenn auch nur in zivil.
Er suchte sich eine Taverne, die Fremdenzimmer anbot und warf dem Wirt zwei Silbermünzen auf die Theke. Ein Gardist seiner Lordschaft musste für Kost und Logis dem Gesetz nach nicht aufkommen, doch Triborin hatte ein Gefühl dafür, wann und wo es wichtig war, einen Verbündeten zu haben. Eine Taverne gehörte, selbst im Heimatland, zweifelsohne zu diesen Orten.
Triborin setzte sich an einen kleinen Tisch im Eck. Der Wirt hatte ihm ein dunkles Gewürzbier und einen Bohnen-Kartoffeleintopf an den Tisch gebracht und der junge Dunkelelf hatte erst, als ihm der Duft der warmen Mahlzeit in die Nase stieg, gemerkt, wie hungrig er war. Er saugte mit dem trockenen Brot die letzten Reste der köstlichen Sauce aus der Tonschüssel. Angenehm gesättigt ließ er seinen Blick durch das Lokal schweifen. Es gab die üblichen Gäste: Männer, die zusammengesunken an der Theke hingen und sich an einem Krug festhielten, Gruppen von Leuten, die Karten spielten und Münzen über den Tisch schoben und jene, die wie Triborin einfach nur alleine da saßen und zusahen. Sein Blick traf den des Mannes genau gegenüber, dessen Gesicht im Schatten der Kapuze seines dunkelgrünen Umhangs lag. Triborin konnte das Schimmern zweier grüner Augen ausmachen. Er ließ seinen Blick weiter wandern und orderte ein neues Bier. Dann sah er wieder hinüber, doch der Mann war fort. Er schaute zur Tür, zur Theke und in das andere Eck des Schankraumes, doch keine Spur von dem Fremden. Als er das nächste Mal wieder geradeaus blickte, hätte er vor Schreck beinahe seinen Krug umgestoßen.
„Ich dachte, ihr Leibgardisten fürchtet euch nicht.“
Die Stimme klang warm und melodisch. Es war die Stimme einer Frau.
„Ich fürchte mich nicht. Ich hatte Euch nur nicht kommen sehen und war überrascht, das ist alles.“
„Das meine ich nicht. Ihr habt dem Wirt Geld gegeben, als Ihr eintratet.“
Sie lachte. „Schon wieder überrascht?“
„Ein wenig“, er lächelte. Wenn sie ein Spiel spielen wollte, dann sollte es so sein. „Aber ich muss Euch enttäuschen. Soldaten des Lords haben keine Angst. Wir verstehen es nur, uns das Leben einfach zu machen und gehen Ärger aus dem Weg. Anders als ihr, nicht wahr?“ Er trank einen Schluck, während sie ihn weiter aus dem Schatten ihrer Kapuze musterte.
„Wieso solltet Ihr euch sonst unter einer Kapuze verstecken? Ich wüsste nicht, dass Frauen in den Tavernen Kaachors verboten wären. Also: woran kann es liegen?“
Er tat so, als grüble er, tippte sich mit dem Finger ans Kinn und sah sie dann wieder direkt an: „Ha, ich habe es: Ihr seid eine Albe.“
Triborin meinte ein Lächeln unter der Kapuze zu erkennen.
„Also gut, Herr Soldat, ich werte das als Unentschieden.“
Sie winkte dem Wirt, der ihr wortlos einen Becher Honigwein servierte. Sie trank und schob die Kapuze gerade so weit zurück, dass Triborin ihr Gesicht erkennen konnte. Er hatte sich nicht getäuscht: ihre Augen leuchteten grün wie ein strahlender Smaragd und wurden durch das rotbraune Haar nur umso mehr hervor gehoben, das sich zu beiden Seiten sanft an ihr ebenmäßiges Gesicht mit den auffallend hohen Wangenknochen anschmiegte. Nie zuvor hatte Triborin eine Albe gesehen. Es stimmte, was man über ihre Schönheit sagte.
„Ich bin Liena“, sagte sie und streckte Triborin eine schlanke Hand entgegen. Er nahm sie und deutete einen Handkuss an.
„Ich heiße Triborin, sehr erfreut. Was bringt euch nach Kaachor?“
„Geschäfte. Und Euch? So weit von Xarchavas entfernt trifft man selten einen der Euren.“
„Geschäfte“, Triborin zwinkerte.
„Natürlich“, antwortete Liena und lächelte verschmitzt. „Auf jeden Fall Geschäfte von Herrn Xyrius, so viel ist sicher oder wirst du gar ein Abtrünniger sein?“
„Wie kommt es, dass du so viel über uns weißt, frage ich mich.“
„Ich verbringe viel Zeit in Lacharys“, antwortete Liena. „Heutzutage kann man sich auch mein Volk wieder frei in eurem Land bewegen.“
„Oder zumindest unter einer großen Kapuze“, zwinkerte Tin.
Linu
Am nächsten Tag war Schule. Linu saß in der kleinen Hütte und sollte eigentlich die Namen der Pflanzen aufschreiben, die vor ihr auf dem Pult lagen, doch sie starrte gedankenverloren vor sich hin. Draußen lernten die Kleinsten gerade den kontrollierten Wechsel ihrer Wesensform. Aviarenkinder wechselten unbewusst und nach Gefühlslage ständig ihren Körper, was durchaus gefährlich sein konnte. Zwar gab sich das von alleine, doch teilweise erst, wenn die Kinder zehn Jahre alt waren. Deshalb hatten die meisten Dorfverbände vor einiger Zeit Frühklassen für die vier bis sechs Jährigen eingeführt, die sie mit einem Wechselführerschein abschlossen.
Eigentlich war die ganze Grübelei hinfällig. Linu hatte sich längst entschieden, dass sie sich auf die Suche machen würde. Wieder und wieder hatte sie die Geschichten durchgekaut und war zu dem Schluss gekommen, dass sie handeln musste, um weiter zu kommen. Der einzige ihr bekannte Anhaltspunkt aus Mins Erzählungen waren die Menschenaffen im Attalongebirge. „Da weiß ich zumindest, dass es sie gibt“, hatte sie gedacht und versucht zu verdrängen, was sie noch wusste. Das Affenvolk duldete die ihren nicht in ihrer Mitte, das lernten die Schüler schon früh. Trotzdem musste sie es versuchen. Die Neugierde und die Qual der Unwissenheit nagten zu stark an ihr.
Zu Hause würde sie erzählen, dass sie sich in der Schule freiwillig für eine Exkursion gemeldet hatte. Natürlich würde das auffliegen, doch sie hoffte dann bereits weit genug entfernt zu sein, um eingeholt werden zu können. Sie brauchte nur einen Tag Vorsprung, vielleicht zwei. Ihr Rucksack lag bereits gepackt unter ihrem Bett: Wechselkleidung, eine Trinkflasche, etwas Trockenbrot und ihr kleines Taschenmesser. Sonstige Nahrung konnte sie in Vogelgestalt ohne Probleme beschaffen. Sie wusste nicht genau, wo sie hingehen musste, um die Menschenaffen zu finden, doch das Attalongebirge war kaum zu übersehen und so würde sie erst einmal direkt auf dessen Zentrum zusteuern.
In der großen Pause kam Taal auf sie zu.
„Was ist los, Linu? Dich beschäftigt etwas.“
Ihr bester Freund sah sie mit seinen grau-blauen Augen an. Er durchschaute sie immer, lügen war zwecklos.
„Ich gehe fort, Taal; zu den Menschenaffen.“
„Ich weiß“, antwortete der Junge nur und wuselte sich durch das kurze blonde Haar. „Und ich komme mit.“
Linu wollte widersprechen, doch Taal kam ihr zuvor.
„Du brauchst es gar nicht versuchen. Ich werde dich auf jeden Fall begleiten. Selbst, wenn du meine Hilfe nicht brauchst – und das bezweifle ich – wirst du dich zumindest über etwas Gesellschaft freuen.“
Linu sah ihren Freund eine Zeit lang an. Dann fiel sie ihm um den Hals.
Linu war nicht sonderlich überrascht, dass Taal ebenfalls bereits gepackt hatte. Unmittelbar nach dem Mittagessen verließen die beiden heimlich das Dorf und marschierten in Richtung des Attalon-Gebirges. Ihre Heimat lag ganz im Osten der Hauptinsel Caeron, sodass sie bereits drei Tage bräuchten, um nur die Grasebenen hinter sich zu lassen. Linu hatte eine grob skizzierte Karte ihres Vaters mitgehen lassen. Auf dem Weg in den Wald und ins Gebirge würden sie mehrere andere Dörfer passieren. Linu wollte die Orte unbedingt umgehen. Die Gefahr, dass sie aufgehalten und zurück nach Hause gebracht würden, war zu groß. Auf Caeron kannte fast jeder jeden.
„Morgen Nachmittag werden sie es wissen“, sagte Taal. „Wir sollten heute Nacht durchmarschieren.“
Linu nickte. „Wenn wir Glück haben finden wir morgen ein paar Felder durch die wir gehen können. Vater ist ein schneller Flieger. Er wird uns eingeholt haben und Kreis um Kreis über den Himmel ziehen.“
„Mach dir keine Sorgen. Die Insel ist so breit, es wäre ein Wunder, wenn sie uns fänden.“
Die beiden Kinder lächelten sich an und trotz der Aufregung über das begonnene Abenteuer fragte sich Linu, ob gefunden zu werden ihre größte Sorge war.
Sie kamen gut voran. Als die Sonne hinter den gewaltigen Gipfeln des Gebirges verschwand, hatten sie bereits die Rauchschwaden von zwei anderen Dörfern passiert, die sie mit ihren Eltern des Öfteren besuchte. Mit der Dunkelheit kamen die Insekten und als sie es nicht mehr aushielten, beschlossen Linu und Taal ein Stück zu fliegen, in der Hoffnung, ihre Eltern suchten nicht bereits nach ihnen.
Als sie hinauf in den Himmel gestiegen waren, bot sich ihnen ein Anblick, der sie in Staunen versetzte. Durch die Höhe kam der goldene Rand der Sonne wieder in Sicht, vor dem die zerklüfteten Gipfel zu schwarzen Silhouetten mutierten und der die Spitzen der am höchsten gelegenen Riesenmammutbäume in warmes Licht tauchte.
[Platzhalter 1: Kapitel ist noch fertigzustellen]
Rak
Matthes entfernte das Gebüsch mit seinem kurzen Schwert.
„Was ist das?“, raunte Bastian, der Metzgerjunge aus einiger Entfernung.
„Ein Stein, was sonst“, warf Jasper ein.
„Das ist kein normaler Stein“, sagte Sara. „Seht doch wie die Luft um ihn herum vibriert und wie es summt.“
Der Rest der Gruppe schloss auf zu Rak und Matthes.
Jasper streckte die Hand nach dem kleinen Pfeiler aus.
„Vielleicht sollten wir es lieber nicht anfassen“, sagte Rak unsicher.
Klara schnaubte. „Hast du Angst, Brötchen?“
„Er hat Recht“, sagte Sara. „Wir wissen ja gar nicht, was das ist. Vielleicht sollten wir die Ritter rufen.“
„Spinnst du? Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, bis ich sie davon überzeugen konnte, dass sie nicht pausenlos direkt hinter mir stehen müssen? Lasst mich machen, immerhin bin ich die Tochter der Königs. Im Gegensatz zu euch bin ich nicht so ein Angsthase.“
Klara streckte die Hand aus und legte sie auf den Pfeiler. Ihre Augen weiteten sich kurz, dann aber lächelte sie.
„Seht ihr, ihr Feiglinge? Das ist nur ein Wegestein! Früher hat es solche Markierungen oft gegeben, bevor gute Landkarten entstanden.“
Zufrieden wollte sie ihre Hand wieder wegziehen, doch es ging nicht. Entsetzen machte sich in ihrem Gesicht breit und Rak folgte ihrem Blick bis zur Hand und sah den Grund dafür: der Stein bewegte sich. Es sah ein bisschen aus wie grauer Brötchenteig und langsam schloss sich die Masse um Klaras Hand.
„Tut etwas, so tut doch etwas!“, rief die Prinzessin verzweifelt.
Die merkwürdige Steinmasse hatte bereits ihr Handgelenk erreicht und es wirkte nicht so, als würde er dort stoppen. Hilflos stand die Gruppe Jugendliche um das Mädchen und starrte aus bleichen Gesichtern auf den verschwindenden Arm. Mittlerweile hatten die Ritter die Gruppe erreicht.
„Euer Majestät, was habt ihr getan?“, rief einer aus, den Rak als Sir Wernett erkannte. Klara schrie wie am Spieß, doch auch die Ritter schienen unfähig etwas zu tun. Bevor er wusste was er tat, griff sich Rak Matthes‘ Schwert und trennte mit einer schnellen und gezielten Bewegung die Hand der Prinzessin ab.
Klara verstummte kurz. Rak spürte alle Blicke auf sich. Dann begann die Prinzessin wieder zu schreien, dieses Mal vor Schmerz.
Rak stand da wie erstarrt. Was hatte er getan?
Klara weinte und schrie und es war fast schon erlösend, als sie schließlich das Bewusstsein verlor.
„Du hast die Prinzessin verletzt!“, rief Sir Wernett.
„Ich… ich habe sie gerettet“, stammelte Rak.
„Du hast die Klinge gegen Eure Majestät erhoben“, beharrte der große Mann. „Das wird mit dem Tode bestraft.“
Rak wollte etwas erwidern, doch Jasper erhob zitternd die Hand und zeigte auf die Prinzessin.
„Klara! Was passiert mit ihr?“
Die anderen folgten seinem Blick. Die Haut der Prinzessin verfärbte sich grau und schien brüchig zu werden.
„Sie verwandelt sich in Stein“, flüsterte Rak eigentlich mehr zu sich selbst, doch Sir Wernett blickte ihn aus strengen blauen Augen an.
„Du scheinst ja sehr genau Bescheid zu wissen…“
Weiter kam er nicht. Klara öffnete die Augen und sah sich panisch um. Ihre Pupillen tanzten in den Höhlen, doch kein Laut kam aus ihrem Mund.
„Sir, wir müssen sie ins Schloss bringen“, sagte einer der anderen Ritter und Sir Wernett nahm widerwillig seinen Blick von Rak. „Bringt sie zu meinem Pferd, Sir Merin, Sir Penleff und danach legt diesen Bastard in Ketten und werft ihn in den Kerker.“
Rak stand wie erstarrt da, als wäre er ebenfalls versteinert. Er hatte doch nur helfen wollen! Während die anderen nur zugeschaut hatten, hatte er instinktiv gehandelt. Er spürte eine Hand an seiner Schulter. Scheinbar waren die Ritter schon zurück, um ihn abzuführen.
„Folg mir, Junge. Schnell. SCHNELL!“, sagte eine fremde Stimme.
Im Nachhinein erinnerte Rak sich nur noch, dass er sich hatte wegziehen lassen, dass er in den Umhang des Fremden gehüllt und in den Wald geführt worden war. Er hatte zurück geblickt, doch seine Freunde starrten alle gebannt auf den Pfeiler.
„Hier hinauf“, drang die fremde Stimme in sein Bewusstsein und wie ferngesteuert machte sich Rak daran, auf den Baum zu klettern. Der Fremde hatte einen guten Baum gewählt. Sein Blattwerk war dicht und die Äste stark. Als Rak nach unten blickte, konnte er den Boden nicht mehr sehen. Mit einer Geste bedeutete der Mann Rak still zu sein und das erste Mal sah er dessen Gesicht: er hatte dunkelblondes Haar und gebräunte Haut und seine Augen waren ebenso tief braun wie seine eigenen.
„Wo ist er?“
Das war Sir Wernetts Stimme.
„Er kann doch nicht einfach verschwunden sein. Ihr standet alle direkt neben ihm!“
„Ich schwöre, er war plötzlich weg“, sagte Matthes.
„Lüg nicht!“
„Es ist die Wahrheit“, sagte Sara. „Ihr könnt Sir Kartoff fragen.“
Dann war Stille. Rak vermutete, dass Sir Wernett zu Saras Ritter gegangen war, der mit Sicherheit wie immer in einigem Abstand seinen Schützling beobachtet hatte.
„Sie werden das Ufer und das Waldstück durchsuchen. Wir müssen uns noch etwas gedulden.“
Rak wollte den Fremden so viel fragen. Wer war er? Wieso hatte er ihn fortgebracht und wie hatte er ihn fortgebracht? Doch alles was er herausbrachte was: „Sie werden uns finden! Sie werden auch auf den Bäumen nachschauen.“
„Hab Vertrauen.“ Der Mann entblößte perfekte Zähne. Seine Stimme war wie Honig.
„Ich muss nach Hause! Ich muss meine Eltern warnen.“ Die Erkenntnis traf Rak wie ein Schlag ins Gesicht: wenn sie ihn nicht finden konnten, würden sie seinen Vater zur Rechenschaft ziehen. Seinen guten, fleißigen Vater, der unermüdlich arbeitete und schuftete und dafür sorgte, dass es ihrer Familie gut ging, es an nichts mangelte, wo andere mit Hunger und Kälte zu kämpfen hatten. Auf einmal schämte sich Rak für seine kindischen Fantasien und für seinen Egoismus, der ihn so unzufrieden gemacht hatte, während seine Eltern ihr ganzes Leben dafür opferten, dass er behütet und gesund aufwuchs. „Ich muss!“, drängte er. „Sie werden sie holen.“ Heiße Tränen flossen ihm die Wangen hinab.
„Das geht nicht, mein Junge. Es ist zu spät.“