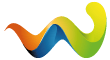[block]Noah&Rachel[/block]
Ich hatte wieder so einen Traum. Ich war unten auf der Straße vor meinem Elternhaus. Ich verließ den 49zigsten Platz, bog von dort aus links auf die Dallas Lane ab und folgte der Straße, bis sie mich auf den Wanderweg führte. Ich folgte einfach dem langen Wanderweg den Elm Creek entlang, wie ich es früher immer getan hatte, bis ich den Elm Creek Damm hinter mir ließ und einfach immer weiter lief. Schritt um Schritt. Ich hatte viel Zeit nachzudenken, aber ich dachte an gar nichts. Ich fühlte wie die frische, kühle Luft um mich herum meine Lunge füllte. Ich atmete gleichmäßig, ein und aus. Ich lauschte dem ruhigen Windspiel der Blätter, einzelnen Vogelrufen, dem seichten fernen Rauschen des Flusses.
Und obwohl eben noch die Nacht Dunkelheit über alles um mich herum gelegt hatte, war es im Schatten der Bäume, die den Weg säumten und über mir ihr herbstlich buntes Blätterdach ausbreiteten, plötzlich Tag geworden. Ein kühler Herbstmorgen.
„Ist das nicht schön?“ Zufrieden sog sie neben mir laufend die Luft ein. Ihre Schritte waren das Echo meiner eigenen. Sie hatte die Hände in ihre Taschen gesteckt. Der Fellrand ihrer Kapuze umrahmte ihr rundes Gesicht. Sie sah mich an und sie verzog ihre Lippen zu einem Lächeln. Die vereinzelten Sonnenstrahlen, die durch die Blätter über uns hindurch brachen, warfen helle Flecken auf ihre Erscheinung. Auf die blasse Haut in ihrem Gesicht, die geröteten Wangen, den braunen Stoff ihrer Jacke und die Jeans. Ihre wunderschönen grünen Augen blickten zu mir auf. Diese unvergleichlichen Augen. Mir ging auf, dass es zu lange her war, dass ich sie so deutlich vor mir hatte sehen können, dass ich so tief in sie hineinblicken konnte. Ein Teil von mir war sich des Traumes bewusst. Mir war bewusst, dass sie nicht wirklich hier sein konnte, bei mir. Es war wie ein Fragment aus meiner Vergangenheit, die die Gegenwart trist und grau machte.
Wir waren stehen geblieben. Und ihr Lächeln erstarb mit einem Mal. Ihre Augen hatten sich nicht von mir abgewendet, aber sie fixierten jetzt einen Punkt in meinem Gesicht. Mitleidig verzog sie das Gesicht und das Lächeln, das sie dann zaghaft lächelte, war ein trauriges.
„Noah.“, seufzte sie. Sie streckte ihre Hand nach meinem Gesicht aus, legte die weiche behandschuhte Hand an meine Wange und strich sanft mit dem Daumen die Träne fort, die sich davongestohlen hatte, ohne dass es mir aufgefallen war.
„Weine doch nicht.“, flüsterte sie, „Ich habe mich so gefreut dich wiederzusehen. Bitte weine jetzt nicht.“ Ich erwiderte ihr nichts. Da waren keine Worte, weder auf meiner Zunge, darauf wartend ausgesprochen zu werden, noch formte sich irgendetwas, das ich ihr hätte sagen können in meinem Kopf. Dabei wusste ich, dass es viele Dinge geben musste, die ich ihr unbedingt sagen wollte. Eben war da noch eine ganze Menge gewesen. Ich konnte es daran spüren, dass sich mein Innerstes so schmerzlich zusammenzog.
„Weißt du, dass du dich kaum verändert hast?“, fragte sie leise. Ihre Stimme war ein sanftes Säuseln. Meine Ohren hatten beinahe diesen herrlichen Klang vergessen.
„Ich wäre so gern bei allem dabei gewesen.“, sprach sie weiter, „Es tut mir so leid, Noah.“ Sie stellte sich auf ihre Zehenspitzen und fast automatisch beugte ich mich ein Stück zu ihr herunter. Sie hauchte einen zarten Kuss auf meine Lippen. Sehnsucht stieg in mir an. Ich hätte sie gern festgehalten. Aber meine Hände blieben wo sie waren. Tief in meinen Manteltaschen ballte ich sie zu Fäusten.
„Komm zurück.“ Mein sehnlichster Wunsch sprang mir über die Lippen. Ihr Gesicht verlor allen Ausdruck. Dann blinzelte sie perplex. Ihr Blick glitt von mir ab und sie neigte den Kopf.
„Es tut mir leid.“, sagte sie, „Das kann ich nicht.“
„Dann sag mir, wo du bist. Sag mir doch endlich, wo ich dich finden kann.“, verlangte ich verzweifelt.
„Noah, bitte. Hör auf.“ Als sie nun das nächste Mal zu mir aufblickte hatte sie begonnen zu weinen. Ihre Wimperntusche verlief ihr unter den Augen und färbte die Tränenrinnsale grau. Ihre Schultern bebten. Ich zog sie in meine Arme, spürte das Gewicht ihres Kopfes auf meiner Brust. Ich drückte sie ganz fest an mich. Ihre Finger krallten sich in den dunklen Stoff meines Mantels.
„Rachel, es tut mir leid, aber...aber ich kann nicht. Bitte, verlange das nicht von mir. Ich kann nicht aufhören. Das mache ich nicht, niemals.“
Sie lachte unter ihren Tränen freudlos auf.
„Ich weiß.“, sagte sie gedämpft durch den dichten Stoff vor ihrem Gesicht und schniefte.
„Das weiß ich ja.“ Sie legte den Kopf in den Nacken und sie fing meinen Blick fest ein.
„Aber ich wünschte, du könntest es.“, sagte sie bestimmt mit weinerlich unterlegter Stimme. Die Intensität, die dabei in ihrem Blick lag und das Gesagte untermauerte, erschreckten mich.
„Sag das nicht.“, bat ich.
Um uns herum zogen dichte Nebelschwaden auf. Sie türmten sich auf und schlängelten sich durch die Umgebung. Sie verschluckten den Wald, die Bäume und den Boden unter unseren Füßen, die Blätter über unseren Köpfen, waberten milchig um unsere Körper. Sie drohten uns zu verschlingen und in ein Nichts zu tragen. Mein Körper begann sich seltsam taub anzufühlen und ich wusste, der Nebel würde uns wieder voneinander trennen. „Rachel.“, flehte ich, „Ich liebe dich.“ Ich umklammerte sie noch fester. Doch ich spürte, wie ihre Finger sich um den Stoff des Mantels lösten. Sie hob die Mundwinkel zu einem schmalen Lächeln an, aber die Traurigkeit, die ihr in dem Moment innewohnte, ließ nicht zu, dass es ihre Augen erreichte.
„Ich weiß.“, sagte sie.
Der Nebel nahm sie mit sich fort und da war nichts mehr in meinen Arme, außer dem so real erscheinenden Gefühl, jemanden gehalten zu haben.
Ich lag unter meiner Bettdecke in meinem Schlafzimmer. Das Kissen unter meinem Kopf war feucht und die rauen Rückstände salziger Tränen klebten unter meinen Augen.
Sechs Jahre. Eine halbe Ewigkeit her. Vor sechs Jahren hatte ich sie zum letzten Mal gesehen. Rachel. Bevor sie spurlos verschwunden war.
Ich stütze mich auf meinem Arm ab, um mich aufzusetzen und schwang die Beine über die Bettkante. Ich starrte die dunklen Umrisse meines schmalen Bücherregals an und darüber in die Tiefe meiner aufgewühlten Gedanken. Das unsagbar große Verlangen nach Maple Grove zu fahren und dort den Medicine Lake Wanderweg entlang zu gehen zerrte an mir. So stark hatte ich das schon lange nicht mehr empfunden. Es war beinahe intensiv genug, dass ich aufgesprungen wäre, mir den Mantel tatsächlich übergeworfen hätte und unten in den Wagen gestiegen wäre. Ein dunkelroter Polo 6n2. Es war eigentlich gar nicht mein Wagen, sondern ihrer. Vielleicht war es ungesund, dass ich ihn von ihren Eltern angenommen und behalten hatte. Aber er hatte zu ihr gehört wie Hüftjeans, abstrakte Sonnenbrillen, bunte Kreolen, Blumenmuster und Shirts in schrillen Farben. Wenn ich nur eine Sache hatte, die ihr gehörte, hatte ich das Gefühl, ich war ihr noch irgendwie nah. Es stimmte nicht, aber ich wollte, dass es so war.
Ich fuhr mir frustriert stöhnend mit den Händen mehrmals über mein Gesicht. Dann stand ich auf und trat durch die schmale Tür in der gegenüberliegenden Wand neben dem Regal in das kleine Badezimmer, das zu meiner Einzimmerwohnung in Virginia gehörte, die es eigentlich gar nicht geben durfte, in einer anderen, besseren Gegenwart, die ich in der Vergangenheit für selbstverständlich gehalten hatte. Ich drückte den Lichtschalter herunter und die Lampe über dem Spiegelschrank, der über dem Waschbecken hing, glomm hell auf.
Ich musterte mein Spiegelbild. Mein Gesicht war fahl, fast krankhaft blass. Das Licht, das es von oben herab anstrahlte, verstärkte den Eindruck. Meine Wangen wirkten eingefallen und meine dunklen Haare lockten sich stumpf und zerzaust bis über meine Ohren. Ich zog das Haargummi von meinem Handgelenk und band mir das Haar am Hinterkopf zusammen. Ein paar Strähnen waren zu kurz um davon gehalten zu werden und sie fielen zurück in mein Gesicht. Ich stütze mich auf das Waschbecken und starrte hinab auf das gewölbte Porzellan. Ich würde nicht nach Maple Grove fahren. Ich würde es nicht tun.
Ich kehrte nicht einmal zu Weihnachten nach Hause zurück, auch nicht zu Geburtstagen, also würde ich jetzt auch nicht wegen irgendeines verrückten, irrationalen Verlangens zurückfahren, das ein Traum in mir erweckt hatte. Denn sie würde nicht wirklich dort sein. Ich öffnete den Wasserhahn und formte meine Hände zu einer Mulde, in der ich das kalte Wasser auffing, um mein Gesicht hinein zu tauchen. Ich war so verloren zwischen jetzt und gestern. Ich konnte weder die Vergangenheit loslassen, noch die Gegenwart akzeptieren und die Zukunft ohne das Mädchen, das ich so lange schon geliebt hatte, dass ich mich nicht an eine Zeit davor erinnerte, drängte sich mir übel auf.
Als ich wieder auf meiner Bettkante saß, hielt ich mein Telefon in der Hand. Ich wählte die Nummer meiner kleinen Schwester. Es war erst vier Uhr früh, aber ich brauchte dringend jemanden zum Reden. Nach dem zweiten Klingeln ging sie ran. „Hallo?“ Ihre Stimme klang belegt, verschlafen, aber aufgeregt. „Noah?“, hörte ich sie fragen, als könnte sie nicht glauben, dass ich es wirklich war.
„Ja, hi. Ich bin‘s.“ Ich hatte sie schon eine ganze Weile nicht mehr angerufen. Das letzte Mal lag bestimmt zwei Monate zurück.
„Noah, ich hab deine Nummer auf dem Display gesehen. Ich weiß, dass du es bist.“, lachte sie verlegen.
Ich stieg in das verlegen Lachen mit ein.
„Ja, stimmt. Ich meine...natürlich.“ Für einen Moment grinste ich sogar. Aber es hielt nicht lange an. Ich zupfte verunsichert an dem Stoff meiner Jogginghose und wartete darauf, dass sie etwas sagte. Ich hörte sie am anderen Ende seufzen.
„Ach Noah.“, sagte sie und sie klang dabei so erwachsen, dass mir ganz anders wurde.
„Willst du mir sagen, wie es dir geht?“, fragte sie hoffnungsvoll.
„Nein...eigentlich...nicht.“, antwortete ich stammelnd, obwohl genau das Gegenteil der Fall war. Mein Herz pochte seltsam aufgeregt. Wieder entfuhr mir ein verlegenes Lachen und ich fuhr mir über die Haare, hob die losen Strähnen dabei aus meinem Gesicht. Ich hatte plötzlich Angst, dass wir uns meinetwegen irgendwann fremd würden.
„Warum rufst du dann an? Hast du wieder schlecht geträumt?“, hakte sie nach und traf genau ins Schwarze. Ich legte den Kopf in den Nacken und starrte an die Decke, bemüht die Tränen weg zu blinzeln, die die sich in mir ausdehnende Traurigkeit erneut mit sich brachte, weil ich immer noch an Rachel denken musste, immer noch von ihr träumte, selbst nach so vielen Jahren noch und weil Piper immer älter wurde, ohne dass ich etwas davon mitbekam. Ich senkte den Kopf wieder und schluckte. Ich fühlte mich schuldig, weil sie ihren Bruder missen musste und ich schämte mich, weil ich davongelaufen war und einfach nicht damit aufhören konnte. Ich wusste nicht, wann es enden würde. Ich fürchtet mich davor, dass es nie enden würde. Aber das konnte ich ihr nicht sagen.
„Nein. Ach, nein, weißt du, ich konnte einfach nicht schlafen.“, behauptete ich wenig überzeugend.
„Achso.“, murmelte sie. Es schmerzte mich, wie enttäuscht sie klang, weil ich mich ihr nicht öffnete, ihr nicht die Wahrheit sagte. Aber sie bohrte nicht nach. Ich hatte sie sicher bereits schon einmal zu oft zurückgewiesen.
Eine Weile lang schwiegen wir uns an. Ich wusste nicht, was ich ihr sagen sollte. Mir lag eine Ewigkeiten alte Entschuldigung auf der Zunge, die ich aber, wie alles andere auch nicht auszusprechen wagte. Es fühlte sich seltsam an, lasch.
„Noah?“, setzte sie schließlich fragend an und beendete die Stille. „Ja, Piper?“ Sie überlegte noch einen Moment, wie sie mir sagen sollte, was ihr selbst auf dem Herzen lag. Aber am Ende entschied sie sich, wie ich doch nichts zu sagen. Stattdessen stieß sie ein resigniertes Seufzen aus.
„Du solltest Mum anrufen.“, meinte sie bloß.
„Ja...ich weiß.“, seufzte ich nun. Schon wieder Stille. Ich schämte mich nur noch mehr wegen Allem, je länger unser holpriges Gespräch andauerte.
„Gut...Dann lass mich mal weiterschlafen. Ich hab morgen Schule.“, hob sie schließlich an.
„Achso, ja. Natürlich. Tut mir leid, dass ich dich mitten in der Nacht angerufen habe.“, entschuldigte ich mich.
„Schon gut. Nacht, Noah.“, verabschiedete sie sich.
„Gute Nacht Piper. Ich hab dich lieb, vergiss das nicht, in Ordnung?“, bat ich flehentlich.
„Mach ich nicht.“, versprach sie sanft, „ Hab dich auch lieb Noah.“
Bevor sie auflegte atmete sie noch einmal hörbar auf, als wollte sie doch noch loswerden, was sie belastete. Ich konnte mir gut vorstellen, worum es dabei ging. Aber sie ließ es bleiben und ich fragte sie nicht. Stattdessen war die Leitung keine Sekunde später unterbrochen.