Das erste Buch der Asche
Das erste Buch der Asche berichtet von den Jahren, als die Katastrophe sich anbahnte, und von der Katastrophe selbst. Es erzählt von den mächtigen Hexerfamilien und ihren Fehden, vom Szepter der Macht und dem Kristall der Vorsehung, vom Ascheregen und dem Untergang von Thalas'Enara und davon, wie am Ende nicht Magie, sondern ein mutiger Sterblicher das Überleben des Volkes sicherte.
Von der Saat der Zwietracht
Die Hexerfamilie Ildanach hatte es zu Macht und Ansehen gebracht. Im Wesentlichen waren sie es, welche die Geschicke der Stadt lenkten, seit der Rat der Gerechten entmachtet worden war. Doch in den Schatten lauerten die Morcantes, stets bereit, Zwietracht zu säen und die neue Ordnung zu stören, die die Ildanachs so sorgsam hüteten, denn auch sie hatten viele Ideen, die sie verwirklicht sehen wollten. Die Spannungen zwischen den beiden Familien sind so alt wie die Zeit selbst, und es wird gesagt, dass ihr Kampf das Schicksal von Thalas’Enara besiegeln wird – eine Stadt, die dazu bestimmt ist, in den Fluten des Äthermeeres zu versinken und nur noch in Legenden zu existieren.
Die Ildanachs waren bekannt für ihre unvergleichliche Beherrschung des Geists. Sie regieren Thalas’Enara mit einer Mischung aus Weitsicht und eiserner Faust, die Nichtmagier verachtend und immer wachsam gegenüber den Intrigen ihrer Erzfeinde, den finsteren Hexern der Familie Morcante.
Die Ildanachs, angeführt von ihrem Patriarchen Eldrin Ildanach, waren Hüter des Kristalls der Vorsehung, eines uralten Relikts, das sie aus den Tiefen der Welt mitgebracht hatten und welches die Macht besaß, die Gedanken der Götter zu zeigen. So war der Kristall der Vorsehung zu einem Symbol der Herrschaft geworden, und man hatte es auf ein Szepter gesetzt. Doch die Morcantes, unter der Führung der ruchlosen Hexerin Margot Morcante, trachten danach, das Szepter an sich zu reißen und selbst die Kontrolle über Caltharnae zu erlangen.
Vom Kristall der Vorsehung
Die Hexer, deren Augen durch die Schleier der Sterblichkeit getrübt sind, erblicken in ihm ein Artefakt von unermesslicher Macht, ein Zeugnis der Weisheit, die jenseits der Grenzen ihrer Welt liegt. Sie wissen nicht, dass der Kristall des Geschicks einst ein Herzstück der großen Maschinen war, die unter Asamura ruhen. Gespeist von der Energie der Sonne Alvashek hat er seine Bilder das erste Mal gezeigt, als die Menschen die Oberfläche erreichten, und funktioniert nur, wenn er regelmäßig dem Tageslicht ausgesetzt ist. Sie sehen in seinen leuchtenden Bildern nicht die Hervorbringungen einer holographischen Projektion, sondern die Schatten und Lichter des Schicksals selbst. Wenn der Kristall seine Visionen entfaltet, deuten die Hexer sie als Offenbarungen, als Botschaften, die über das Schicksal von Königreichen und der Zeit selbst entscheiden.
Die Hexer verstehen nicht die wahre Natur des Kristalls, so wie sie auch die Quelle ihrer eigenen Macht nicht erkennen. Für sie ist der Kristall ein heiliges Objekt, ein Orakel, das mit den Stimmen der Götter spricht, und sie hüten ihn als den Schlüssel zu den Geheimnissen ihrer Macht.
In den Tagen, als die Dunkelheit über Thalas'Enara zu fallen drohte und die Herzen der Hexer von Zweifeln geplagt wurden, erwachte der Kristall der Vorsehung zu einem unerwarteten Leben. Seine Facetten glühten mit einem Licht, das nicht von dieser Welt zu sein schien, und in seinem Inneren entfaltete sich eine Vision von großer Bedeutung. Die Hexer versammelten sich um den Kristall, ihre Augen weit aufgerissen in ehrfürchtigem Staunen, als die Luft selbst zu flimmern begann. Aus dem Herzen des Kristalls stieg ein Bild empor, klar und leuchtend wie der Morgenstern. Es zeigte eine Stadt, die in Ruinen lag. Ihre Türme waren gebrochen, ihre Straßen leer, und über ihr hing der Schatten des Verderbens.
Als der Kristall der Vorsehung seine Vision entfaltete und die Hexer von Thalas'Enara in stummes Staunen versetzte, erhob sich Eldrin Ildanach, der mächtige Hexerfürst, um zu sprechen. Seine Stimme hallte durch die Hallen, fest und unerschütterlich:
"Fürchtet nicht die Visionen, die vor unseren Augen tanzen", begann Eldrin mit einer Ruhe, die den Raum erfüllte. "Denn wenngleich sie früher mächtige Ratgeber gewesen sein mögen, sind sie heute für uns nur noch Bilder. Wir sind die Meister der Dunkelheit, die Weber des Schicksals und der Zeit. Unsere Macht, geboren aus den Tiefen der Erde und genährt durch Menkalinan, der in der Tiefe ruht, ist unübertroffen."
Er schritt vor den versammelten Hexern auf und ab, seine Robe flatterte hinter ihm wie ein Banner im Wind. "Wir haben den Weg durch die Dunkelheit des Untergrunds bewältigt, sind aus dem Nichts an die Oberfläche gestiegen und haben Thalas'Enara aus dem Staub der Vergessenheit erhoben. Wir haben die Ketten der unwürdigen Nichtmagier zerschlagen und ihre Herrschaft beendet. Was ist eine Vision gegen solche Taten?"
Eldrin hob seine Hände, und das Licht des Kristalls spiegelte sich in seinen Augen wider. "Wir sind die Erben einer Macht, die älter ist als die Sterne selbst. Lasst uns nicht vor den Flüstern des Schicksals zurückschrecken, sondern sie als das erkennen, was sie sind – ein Zeichen unserer unvergleichlichen Stärke. Wir haben die Dunkelheit bezwungen und werden auch das Licht beherrschen. Die Vision ist kein Omen des Untergangs, sondern ein Beweis unserer Größe!"
Die Hexer, denen die Worte schmeichelten, stimmten Eldrin zu. Selbst Eldrins Sohn Aranthir, dessen Zweifel nicht ganz erloschen, schwiegen, denn weder wagte er es, seinem Vater vor den Augen der anderen zu wiedersprechen, noch wollte er als Feigling gelten.
Die erklärten, dass die Vision eine Täuschung sei, ein Spiel des Lichts ohne Bedeutung. Der Kristall der Vorsehung wurde nicht länger gebraucht. Die Hexer versiegelten das Zepter, dessen Spitze er krönte, hinter dicken Mauern und versteckten ihn vor den Augen der Welt. Unter Androhung der Todesstrafe wurde verboten, je wieder von der Vision zu sprechen. Sie glaubten fest daran, dass durch den Mut, die Weisheit und die Einigkeit der Hexer das Schicksal selbst herausgefordert werden konnte. Und weder die Ildanachs noch die Morcantes oder andere mächtige Familien ihrer Zeit verschwendeten noch einen Gedanken an die Weissagung, seit das Zepter mit dem Kristall versiegelt worden war. Sie wandelten durch die Straßen, erhoben über die Sorgen der Sterblichen, und in ihrem Hochmut ignorierten sie die Zeichen der Natur.Sie glaubten, dass nichts und niemand ihre Stellung erschüttern könnte, nicht einmal die Kräfte, die tief im Herzen Asamuras schlummerten.
Die Prophezeiung von Thalas’Enara
Prinz Aranthir, Sohn des Hexerfürsten Eldrin Ildanach, dachte oft darüber nach, was der Kristall der Vorsehung ihnen gezeigt hatte. Der Anblick der zerbrochenen Türme und eingestürzten Häuser hielt sich hartnäckig in seinem Geist. Wenn er durch die Straßen von Thalas'Enara ging und all das betrachtete, was die Menschen aufgebaut hatten, all die Kunstfertigkeit und Schönheit, kehrte die Erinnerung an die Vision zurück. Aranthir war es, welcher der Vision ein Gewand aus Worten schenkte und sie so umschrieb, wie er sie verstand. In den Annalen von Caltharnae, niedergeschrieben in der Ära des Erwachens, findet sich eine Prophezeiung, die das Schicksal von Thalas’Enara vorhersagt:
"In der Zeit, wenn das Bittermeer die Sterne verschluckt
und die beiden Monde sich in Trauer verhüllen,
wird Thalas'Enara, das Herz der grünen Lande,
dem Ruf der Tiefe nicht länger widerstehen.
Die Klingen des Neides werden sprechen,
der wird Kristall zerbrechen, ein Scherbenmeer.
Die Stadt wird erbeben, die Türme werden fallen
und ganz Caltharnae wird schwarze Tränen weinen."
Aranthir komponierte eine Melodie, die nicht überliefert ist, und manchmal sang er sie, ohne die Worte auszusprechen, die er gedichtet hatte.
Kaledor
In den Tagen, da die Schatten der Hexer über Thalas'Enara lagen, lebte Kaledor, Sohn einer alten Linie von Hexenjägern. Er war von nichtmagischem Blut und seine Herkunft war bescheiden, doch seine Taten sprachen von einer Größe, die jene von königlichem Geblüt übertraf.
Er war ein Mann von stiller Stärke und verborgener Tiefe. Seine Vorfahren, einst gefürchtet und verehrt für ihre unerschütterliche Jagd auf jene, die sich der dunklen Künste bedienten, hatten nach der Machtergreifung der Hexer alles verloren. Ihr Besitz wurde genommen und ihr Name geschmäht. So besaß Kaledor keinen anderen Namen mehr als jenen, mit dem man ihn rief. Viele seiner Vorfahren hatten den Tod in den dunklen Kerkern der neuen Herrscher gefunden.
Kaledors Eltern lebten nun ein Leben der Demut und verbrachten ihre Tage in schwerer Arbeit. Seine Mutter klopfte Steine in den Erzgruben von Thalas'Enara, sein Vater schmolz an den Hochöfen das Eisen aus den schweren Brocken und goss es in Barren für die Schmiede. Es waren Dienste, die sie für die Hexer verrichteten, deren Macht sie einst bekämpft hatten.
Kaledor selbst, ein Mann von kräftiger Gestalt, trug das Erbe seiner Familie nicht in Worten, sondern in seinem Wesen, denn er war still und ernst. Sein kurzes Haar war so schwarz wie die nächtlichen Schatten, die über die Türme von Thalas'Enara krochen, und seine Augen glichen dem Eis, das manchmal über das Meer trieb und von Schiffen geerntet und in die Kühlkammern der Hexer verbracht wurde. Durch einen Fürsprecher, seinen starken Körper und seine zurückhaltende Art hatte Kaledor es bis zur Turmwache der Hexer gebracht, eine Position, die ihm erlaubte, über die Stadt zu wachen, die seine Vorfahren einst zu schützen geschworen hatten.
Während er auf den Zinnen der Türme stand, sein Blick fest auf die ferne Dunkelheit gerichtet, wusste er, dass das Blut der Hexenjäger noch immer in seinen Adern floss. Er war ein Wächter, ja, aber in ihm lebte auch der Geist derer, die niemals vor der Dunkelheit zurückgewichen waren. So stand Kaledor, ein Mann zwischen den Welten, sein Schicksal untrennbar verwoben mit dem von Thalas'Enara und den Hexern, die er zugleich bewachte und hasste.
Seine Mutter, die in den tiefen Erzgruben arbeitete, erzählte ihm von den unheilvollen Veränderungen im Herzen der Welt. Sein Vater, der Tag für Tag die Hitze der Hochöfen ertrug, sprach von einem Feuer, das anders brannte als zuvor, denn der Wind hatte sich verändert. Die Luft roch stickig und die Menschen wurden von schwerem Husten geplagt. Die Hexer, hoch oben in ihren Türmen, spürten davon nichts, und taten es als eine der vielen Schwächen der Gewöhnlichen ab.
Kaledor, geprägt von der Weisheit seiner Eltern, erkannte die Zeichen, die andere nicht sahen. Das leichte Beben der Erde, das die anderen als einen fernen Erdrutsch abtaten, kündete für ihn von einem tieferen Schrecken. Die Fischschwärme, die nicht mehr kamen, und die Zugvögel, die nicht mehr auf Caltharnae ausruhten, waren Boten eines drohenden Unheils. Doch Kaledor, dessen Ahnen einst die Dunkelheit gejagt hatten, wagte es nicht, seine Stimme zu erheben. Bei Todesstrafe war es verboten, Prophezeiungen Glauben zu schenken oder sie zu verbreiten. Und in diesen Tagen galt eine jede Warnung bereits als Prophezeiung. Das Volk war angehalten, sein Bewusstsein ganz auf die Gegenwart zu richten und die Planungen für die Zukunft ganz den Hexern zu überlassen. Wer dagegen verstieß, machte sich des Hochverrats schuldig und musste sterben.
So stand Kaledor in seinem Zwiespalt, gefangen zwischen der Pflicht, die Stadt zu warnen, und der Furcht vor dem Zorn der Hexer. Seine Lippen blieben versiegelt, während sein Herz von der Last des Wissens schwer wurde. Und während die Zeichen sich mehrten und das Unheil näher rückte, fand sich Kaledor am Rande einer Entscheidung, die das Schicksal von Thalas'Enara bestimmen sollte.
Derweil mehrte sich die Not des Volkes. Die Fische, die in den Tiefen spielten, verschwanden aus den Netzen der Fischer, als würden sie vor einem unsichtbaren Feind fliehen. Das Trinkwasser wurde bitter und manch einer wurde davon krank. Die Erde selbst begann zu sprechen. Ihr waren Seufzer zu entnehmen, die tief aus ihrem Inneren kamen, ein Stöhnen von Stein und Erz, das die Handwerker und Schmiede in ihren Werkstätten vernehmen konnten. Die Pflanzen faulten auf den Feldern und das Vieh brachte kranke oder tote Junge zur Welt. Die Sterne funkelten mit einem fahlen Licht, als wollten sie sich von der Welt verabschieden, und die Monde waren hinter ihren trüben Schleiern kaum noch zu sehen. Der Wind trug den Geruch von Asche mit sich, die nach Schwefel roch.
Doch schien es, als sei er allein mit seiner Erkenntnis. Das Leben in der Stadt ging weiter wie immer. Und Kaledor fragte sich, ob er den Hexern sagen sollte, welche Beobachtungen er gemacht hatte. Er wusste um die Macht der Hexer, die über Thalas’Enara herrschten, und die Gefahr, die es bedeutete, sich ihnen zu widersetzen, und er zögerte, bis weiße Ascheflocken sich auf die Mauern legten, die zu schützen seine Aufgabe war. Sie war wie heißer Schnee und sie war giftig. Er verstand, dass er ohnehin todgeweiht war, so wie jeder andere, wenn niemand etwas unternahm.
Kaledor verstand, dass das Schweigen ihn zum Komplizen des drohenden Verderbens machen würde. So fasste er den Entschluss, die Hexer zu warnen, und wenn es ihn seinen Kopf kosten würde. Nichts Geringeres hatte er geschworen, als die Stadt mit seinem Leben zu verteidigen.
Als Kaledor sich demhöchsten Turm näherte, erhob sich dieser wie ein Wächter des Himmels vor ihm, seine Spitze in den Wolken verloren. Dort oben residierte Eldrin Ildanach. Die Wände des Turms waren mit Reliefs und Runen verziert, die alles Übel außerhalb der Mauern verfluchten. Der Stein war durchzogen von Adern aus Kristall, die im fahlen Licht der untergehenden Sonne rot wie Blut funkelten. Als Turmwächter gewährten seine Kameraden ihm Einlass, und Kaledor schritt durch das große Eisentor. Die Luft im Inneren war kühl und still, ein heiliger Frieden, der nur vom Echo seiner Schritte unterbrochen wurde. Die Treppe, die sich nach oben wand, war breit und aus dem gleichen Stein gehauen wie die Wände.
Mit jedem Schritt, den Kaledor machte, fühlte er die Last der Geschichte auf seinen Schultern. Die Treppe schwang sich immer höher empor, er ging vorbei an Fenstern, die Blicke auf die Stadt darunter freigaben, eine Stadt, die bald nicht mehr sein würde. Doch Kaledor ließ sich nicht länger von seiner Angst beirren. Mit festem Schritt betrat er die Halle, wo die führenden Köpfe der Herrscherfamilie über die Karten von Caltharnae gebeugt saßen, und bat die erstaunten Hexer darum, ihm für ein einziges Mal zu erlauben, zu ihnen sprechen zu dürfen.
Aranthir
Gemeinsam mit seinem Vater, seinen Brüdern und den übrigen Entscheidungsträgern der Hexer, saß Aranthir am Kartentisch, wo sie über die leeren Jagdgründe der Fischer diskutiert hatten - leergefischt, wie man glaubte. Es geschah höchst selten, dass ein Gewöhnlicher es wagte, unaufgefordert zu den Hexern zu sprechen, denn jede Belästigung wurde hart sanktioniert. Kaledor jedoch gehörte der Turmwache an und es mochte sein, dass sein Anliegen von Bedeutung war. So erteilte Eldrin Ildanach, Aranthris Vater, dem Gast das Wort.
Mit einer Stimme, die von der Dringlichkeit der Nachricht getragen wurde, sprach Kaledor: “Mein Herr, die Natur spricht zu uns, und ich fürchte, ihre Botschaft ist düster. In den Erzgruben ersticken die Arbeiter und es schneit giftige Asche, die unsere Brunnen vergiftet. Meine Eltern, welche die Sprache des Gesteins verstehen, haben mir erklärt, was geschieht, und ich bin in Sorge. Es mag sein, dass sich unter Caltharnae ein Abgrund öffnen wird, um alles zu verschlucken, was darauf lebt. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist.”
In den Hallen des Turms, wo die Familie Aranthirs versammelt war, hallte das Lachen wider, als Kaledor seine düstere Botschaft überbrachte. Die Brüder und Schwestern, die in den Künsten der Magie geübt waren, konnten nicht glauben, dass ein Mann ohne magisches Blut ihnen eine solche Warnung darbringen würde.
“Die Asche ist also ein Omen, sagst du? Und das von einem Mann, der nicht einmal einen einfachen Zauber wirken kann”, spottete einer der Brüder.
“Vielleicht sollten wir ihm ein Amulett geben, damit er sich sicher fühlt, wenn Caltharnae untergeht,” lachte eine der Schwestern. Ihre Augen funkelten vor Belustigung.
Die Hexer verhöhnten Kaledor, nannten ihn einen Narren, der Schatten jagte, wo keine waren. Aranthir jedoch, der die Prophezeiung nicht vergessen hatte, erkannte den Ernst der Lage. Er sah die Sorge in den Augen des getreuen Wächters, die Anspannung in seiner Haltung. Aranthir ahnte, dass Kaledor kein Mann war, der leichtfertig sprach. Er verstand, dass Weisheit oft aus den unerwartetsten Quellen kommt, doch er konnte nicht vor aller Augen und Ohren gegen das Gesetz verstoßen.
In den Hallen des Turms, wo das Lachen seiner Familie noch in der Luft hing, nickte Aranthir scheinbar zustimmend. “Ihr habt recht,” sagte er mit einem Lächeln, das nicht seine Augen erreichte. “Kaledor ist dem Wahnsinn verfallen. Seine Worte sind nichts als Geschwätz.”
"Mit ihm wird seine verbrecherische Linie enden", entschied Eldrin Ildanach. Und die Geste seiner Hand verriet, dass er das Herz von Kaledor dazu zwingen wollte, stillzustehen. Doch der Turmwächter blieb aufrecht stehen. Eldrins Augen wurden schmal vor Zorn, seine Lippen ein blutleerer Strich. Auch Aranthir war verwirrt, denn es war noch nie geschehen, dass jemand der Magie des Hexenmeisters von Thalas'Enara hatte standhalten können.
Auch ein zweiter Versuch schlug fehl. "Bringt ihn fort", rief Eldrin Ildanach aufgebracht und machte eine unwirsche Geste in Richtung der Turmwachen, die zu beiden Seiten der Tür standen.
Und sie ließen den getreuen Turmwächter von seinen eigenen Kameraden in ein Verlies werfen, wo er nackt und frierend auf seine Hinrichtung warten musste. Seine Verwandten aber wurden ohne eine Ausnahme noch in dieser Nacht erschlagen, um den Keim des Frevels, der die Hexer schon einmal in Bedrängnis gebracht hatte, ein für alle Mal auszumerzen. Insgeheim hatten sie vielleicht nur auf einen Vorwand gewartet.
Nacht über Thalas'Enara
In den stillen Stunden, da selbst die Schatten zu schlafen schienen, schlich Aranthir, Sohn des mächtigen Hexerfürsten Eldrin Ildanach, durch die gewundenen Gänge der Kerker von Thalas'Enara. Er war gekommen, um den Mann zu sehen, der einst über die Türme gewacht hatte, Kaledor, den Nachfahren der Hexenjäger. Aranthir erreichte die Zelle, in der Kaledor gefangen war, und sein Blick fiel auf den nackten Mann, der dort lag. Um seinen Hals trug er einen Eisenring, der an die Wand gekettet war. Das fahle Licht, das durch die Gitterstäbe fiel, zeichnete Muster auf die Haut des Gefangenen.
Als Kaledor merkte, dass jemand durch das Gitter sah, erhob er sich. Er ging so weit nach vorn, wie die Kette es erlaubte. "Mein Herr", sagte er nur. In seinen eisblauen Augen spiegelte sich ein Kampf wider, der tiefer ging als die alte Fehde zwischen Hexenjäger und Hexer. Aranthir sah in Kaledor keinen Feind, sondern einen Wächter, der die Stadt beschützt hatte, die sie beiden liebten, selbst um den Preis seines Lebens. Diese Erkenntnis widersprach dem, was man Aranthir gelehrt hatte. Kaledor besaß nichts von der Niedertracht, Feigheit und Verabscheuungswürdigkeit, die den Nichtmagiern innewohnen sollte.
“Kaledor,” flüsterte Aranthir, als er sich ihm näherte. “Ich bitte dich, sprich offen zu mir. Was hast du gesehen? Was hat dir die Erde erzählt?”
“Mein Herr,” antwortete er, “die Zeichen sind unverkennbar. Die Vögel fliehen, die Fische verschwinden, und die Erde seufzt in Schmerzen. Ich fürchte, es wird eine Katastrophe geben, die das Ende von ganz Caltharnae bedeuten könnte.”
Aranthir lauschte ernst. “Dann müssen wir vorbereiten,” entschied er. “Wir werden nicht untätig bleiben, während das Schicksal an unsere Türen klopft.”
So standen sie, der Hexer und der Nachfahre von Hexenjägern, getrennt durch Gitter und Geschichte, doch verbunden durch die Liebe zu Thalas'Enara. Vorerst nahm Aranthir Abschied, doch die Zeit drängte, denn Hinrichtungen wurden nie lange hinausgezögert. So weckte Aranthir seinen Vater, wenngleich dieser ungehalten war ob der nächtlichen Störung.
"Vater, Herrscher über die Gezeiten des Schicksals, ich komme zu dir mit einem Vorschlag, der unserer Macht und Weisheit würdig ist", sprach Aranthir, seine Stimme voller Ehrerbietung. "Kaledor, der Nachfahre der Hexenjäger, dessen Schicksal es ist, den Tod durch unsere Hand zu finden, könnte uns noch im letzten Atemzug dienen."
Eldrin Ildanach blickte ausdruckslos auf Aranthir herab. "Sprich weiter, mein Sohn, und offenbare mir deine Gedanken."
"Lasst uns Kaledor nicht einfach dem Tod übergeben, sondern ihn zum Objekt unserer Experimente machen. Die Magie, die wir beherrschen, ist unermesslich und in vielen Bereichen noch unerforscht. An Kaledor aber ist sie an ihre Grenzen gestoßen. Kannst du sagen, warum? Ich vermag es nicht. Kaledor könnte uns helfen, die Grenzen unserer Kunst zu erweitern, selbst wenn es bedeutet, dass er dabei sein Leben lässt. Statt eines einfachen Endes würde Kaledors Tod uns Erkenntnisse bringen, die das Wissen von Thalas'Enara mehren könnten. Sein Ende würde ein letzter Dienst an den Hexern sein, die seine Familie einst bekämpfte, ein weiteres Zeichen unserer Macht."
Eldrin Ildanach, dessen Gedanken so tief und unergründlich waren wie die Dunkelheit zwischen den Sternen, nickte langsam. "Deine Worte sind weise, Aranthir. Kaledor soll uns in seinem Tod dienen, so wie er es im Leben nicht konnte, dieser Wurm. Er wird Teil unserer Suche nach Macht sein."
In den stillen Stunden der Nacht schlich Aranthir, Sohn des Hexerfürsten, erneut in die Tiefen des Kerkers. Dort, in der tiefsten Zelle, die von der Welt vergessen schien, fand er Kaledor, dessen nackter Leib nur vom Schatten umhüllt war.
"Kaledor, Sohn des Gesteins, dein Schicksal ruht in den Händen meines Vaters", begann Aranthir, seine Stimme ein leises Echo in der Dunkelheit. "Eldrin Ildanach bietet dir einen Pfad, der nicht zum schnellen Tod führt, sondern zu einem, der durch die Pforten der Erkenntnis geht."
Kaledor richtete sich auf, sein Blick so kalt und hart wie das Eis, das aus den nördlichen Meeren manchmal bis an die Ufer von Caltharnae trieb. "Aranthir, dessen Blut mit dem meinen im Streit liegt, sprich klar. Was für ein Pfad soll das sein, der nicht in den Tod, sondern in die Qual führt?"
"Mein Vater sieht in dir trotz deiner niederen Abstammung einen Wert für unsere Experimente. Dein Tod würde nicht nutzlos sein, sondern ein Beitrag zu unserem Wissen", erklärte Aranthir.
"Nein", entgegnete Kaledor mit fester Stimme. "Ich werde nicht als Versuchsobjekt in den Händen derer enden, die meine Familie vernichtet haben. Ich war ein treuer Turmwächter. Ich verlange einen Tod, der schnell und ehrenvoll ist, nicht einen, der über Tage oder Wochen zieht, in denen ich von den Hexern zu Tode gefoltert werde."
Aranthir trat näher, seine Augen suchten die Wahrheit in Kaledors Gesicht. "Es gibt keinen Ruhm im Tod, Kaledor. Doch es könnte einen Zweck geben, selbst in den dunkelsten Stunden."
"Mein Zweck war es, zu wachen, und nun ist es, zu sterben. Aber nicht so", sagte Kaledor und seine Worte klangen endgültig. "Ich lehne das Angebot ab."
Aranthir, dessen Herz von Zweifeln und Ängsten geplagt war, stand vor Kaledor, der stolz und unbeugsam in seiner Zelle verharrte. "Kaledor, ich stehe vor einer Wahl, die schwerer wiegt als die Kronen der Hexerfürsten", begann Aranthir zögerlich. "Ich muss dir vertrauen, obwohl alles in mir sich dagegen sträubt."
Kaledor richtete sich auf, sein Blick fest auf Aranthir gerichtet. "Warum solltest du mir vertrauen, Aranthir? Ich bin dein Gefangener, und mich erwartet der Tod durch die Hand deiner Sippe."
"Weil ich du uns gewarnt hast und weil ich deiner Warnung Glauben schenke. Die Zeichen sind unmissverständlich, irgendetwas passiert, und auch die Hexer ahnen es. Wir haben keine Kentnisse der Natur, aber Kenntnisse der Magie, und uns liegt eine verbotene Prophezeiung vor. Allein damit, dass ich sie erwähne, bin auch ich todgeweiht. Du besitzt nun ein Wissen, dass mich umbringen kann. Bist du nun bereit, mit mir zusammenzuarbeiten?"
"Ich bin bereit, dir zuzuhören. Alles Weitere sage ich dir hinterher."
"Gut", flüsterte Aranthir. "Eine Katastrophe kommt auf uns zu, eine, die Thalas'Enara zu verschlingen droht." Seine Stimme klang nun fester. "Die Prophezeiung stimmt mit dem überein, was du sagst. Und trotzdem wollen mein Vater und die anderen Hexer es nicht wahrhaben. Sie glauben, ihre Macht würde genügen, doch sie könne noch nicht einmal verhindern, dass der Ascheregen aufhört. Stattdessen wird er immer dichter. Ich kann nicht tatenlos bleiben, auch, wenn es meinen Tod bedeutet. Und darin sind wir uns beide sehr ähnlich, ganz gleich, was uns ansonsten trennt."
Kaledor lauschte und das Leben schien in seine eisblauen Augen zurückzukehren. "Was ist dein Plan, Aranthir? Was erwartest du von mir?"
"Ich will dich nicht foltern, noch will ich deinen Tod", gestand er, während er sich mithilfe seiner magischen Gabe vergewisserte, dass niemand ihre Unterhaltung belauschte. "Ich will dich retten, Kaledor, weil du kein Verbrechen begangen hast und weil du sehr viel über die Natur weißt. Ich will, dass wir gemeinsam das Volk auf die bevorstehende Katastrophe vorbereiten, bevor die Dunkelheit hereinbricht."
Kaledor nickte langsam. "Und was erwartest du als Gegenleistung dafür, dass du mich rettest, Aranthir? Warum solltest du, ein Hexer, das Leben Mannes retten, der dem Blute nach eigentlich Hexenjäger sein sollte?"
"Weil es nicht um Hexer oder Hexenjäger geht, sondern um das Volk, das wir beide zu schützen geschworen haben", entgegnete Aranthir . "Wir müssen zusammenarbeiten, um Thalas'Enara zu retten, auch wenn es bedeutet, dass wir unsere alten Fehden begraben müssen."
Kaledors Gestalt schien größer zu werden in der Dunkelheit der Zelle. "Dann lass uns beginnen, Aranthir. Lass uns das tun, was notwendig ist. Ich war ein Turmwächter von Thalas'Enara, und ich werde es wieder sein, auch wenn man mir meine Rüstung und meine Lanze genommen hat."
"Beides wirst du zurückerhalten und noch mehr, wenn wir getan haben, was getan werden muss."
Durch das Gitter reichte Aranthir Kaledor die Hand. So verbündeten sich der Hexer und der Hexenjäger, vereint durch eine gemeinsame Sache, die größer war als ihre eigene Geschichte. Aranthir öffnete die Gittertür, löste die Kette von der Wand und führte Kaledor daran unter dem Hohngelächter der Turmwächter in seinen eigenen Turm. Kaledor biss die Zähne zusammen und schwieg, denn auch seine alten Kameraden wollte er retten. Und in den Tiefen der Nacht begannen sie, einen Plan zu schmieden, der das Schicksal von Thalas'Enara verändern sollte.
Aranthir, der sich gegen seine eigene Familie stellte, riskierte nicht nur seinen Stand innerhalb der mächtigen Hexerfamilie, sondern auch sein Leben. Die Hexer beobachteten jeden Menschen in der Stadt mit Argusaugen, und die Magie, die in ihren Adern floss, konnte leicht verborgene Pläne aufdecken. Jedes Flüstern, jeder Schritt musste mit größter Sorgfalt bedacht werden, denn eine unbedachte Regung konnte den Verdacht der Hexer auf Aranthir und Kaledor lenken.
Aranthir, der in der Kunst der Täuschung geübt war, wob ein Netz aus Lügen und Halbwahrheiten, um die Vorbereitungen zu verbergen. Kaledor, dessen Leben frei von Magie war, beriet Aranthir, durfte jedoch selbst nicht zu viel erfahren. Als Eldrin misstrauisch wurde, weil die Ergebnisse der Forschung auf sich warten ließen, war Kaledor, der Aranthir bat, an ihm zum Schein einige Experimente vorzunehmen, um den alten Hexenmeister zu beruhigen. Aranthir zögerte. In einer Gesellschaft, die von Lügen, Machtgier und Intrigen durchdrungen war wie von einem schädlichen Pilz, war Kaledor sein einziger Freund geworden. Doch Kaledor überzeugte ihn, dass die Sicherheit von Thalas'Enara wichtiger war als seine Gesundheit, und mit schwerem Herzen begann Aranthir ein Forschungsprojekt an Kaledors Körper und Geist.
Mit Zaubern, die aus den ältesten Büchern stammten, und Worten, die in den dunkelsten Nächten geflüstert wurden, versuchte Aranthir, die Mauern zu erschüttern, die Kaledors Gedanken schützten. Er setzte ihn körperlichen Qualen aus, die das Fleisch forderten, und seelischen Torturen, die den Geist zu brechen drohten. Doch bei jedem Schritt, bei jeder Formel, die er sprach, fühlte Aranthir das Gewicht seines schlechten Gewissens. Kaledor, dessen Körper von Narben gezeichnet war und dessen Geist von den Stürmen der Qual gepeinigt wurde, blieb unerschütterlich. Kein Zauber, kein Gift der Worte konnte die Festung seines Willens einnehmen. Aranthir stand vor einem Rätsel, das er nicht lösen konnte. Warum war Kaledor immun gegen seine Magie? War es die Reinheit seines Herzens? Oder war es die Stärke eines Geistes, der durch Leid und Verlust gehärtet wurde? Oder war er selbst einfach zu schwach? Aranthir konnte es nicht sagen. Trotz all seiner Macht, trotz der Tiefe seines Wissens, fand er in den Nächten seiner Forschung keine Antwort.
Derweil fanden die Handwerker der Stadt kaum noch Schlaf, um ein Werk zu vollbringen, das so gewaltig war wie die Hoffnung, die Aranthir und Kaledor in ihren Herzen trugen. Mit Peitschen trieben die Aufseher die Handwerker zur Arbeit an. Stabiles Holz aus den Wäldern von Taurea wurde geschlagen, mächtige Stämme, die Jahrhunderte überdauert hatten. Sie wurden zu Planken geformt, so stark und breit, dass sie den Zorn des Meeres standhalten konnten. Die Zimmerleute arbeiteten Tag und Nacht. In den Webstuben wurde festes Segeltuch gewebt. Die Weberinnen arbeiteten, bis ihnen die Finger bluteten, um riesige Segel zu schaffen, welche die Winde einfangen konnten, die über das Bittermeer wehten. Zehntausende Schiffsnägel aus dem härtesten Eisen wurden in den Schmieden geschaffen. Sie würden in der Lage sein, die Planken fest zusammenzuhalten, selbst wenn das Meer in seinem Zorn um sich schlagen würde. Taue aus den Fasern von Flachs wurden gedreht, stark und doch geschmeidig, um die Segel auch im stärksten Sturm zu halten. Die Schiffsbauer setzten die Masten ein. Die Teersieder, deren Gesichter vom Rauch geschwärzt waren, trugen den Teer auf die fertigen Schiffe, eine schützende Schicht gegen das eindringende Meer. Schiff um Schiff rollte vom Stapel in die bitter schmeckenden Fluten, die am Strand giftigen Schaum hinterließen. Schwarz und groß wie Ungeheuer lag die Flotte vor dem Fischerhafen vor Anker.
Als Vorwand dienten Aranthir die leeren Fischgründe, die er durch eine größere Anzahl an Schiffen und Booten kompensieren wollte. Doch wie weit die Fischer auch hinausfuhren, es waren kaum noch lebende Fische zu finden. Die Schwärme hatten ihre Wanderungen geändert und jeder Fisch, der verblieben war, trieb bleich und aufgedunsen mit dem Bauch nach oben unter den schmutzigen Wellen.
Doch sie arbeiteten gegen die Zeit, denn das Wetter wurde immer schlimmer. Stürmische Böen trugen den Staub der Verwüstung mit sich und rissen die Blätter von den Bäumen. Es gab keinerlei Vögel mehr, weder lebende noch tote. Sie schienen einfach verschwunden zu sein.Die Flüsse schwollen an und traten über die Ufer. Die malerischen kleinen Dörfer, die um Thalas'Enara gelegen hatten, wurden fortgerissen wie Spielzeuge. Für die Tiere des Wassers war ihr Element zur Todesfalle geworden. In Todesangst sprangen sie an Land, um dort zu verenden. Die Leiber riesiger Meeresungeheuer verfaulten an den Stränden, inmitten von millionen silberner Fische, die das Ufer in einen stinkenden Fischfriedhof verwandelten.
Entsetzt stellte Aranthir fest, dass nachts weder Sterne noch die beiden Monde noch zu sehen waren. Der Tag der Prophezeiung war gekommen. Er rief die Menschen zum Hafen, um die schwarze Flotte zu besteigen. Nun konnte er seinen Plan nicht länger verheimlichen und alle Augen der Hexer richteten sich auf ihn. Da erbebte die Erde stärker als je zuvor, und Hexer wie Gewöhnliche stürzten ohne Unterschied zu Boden, als der Zorn der Natur sie in die Knie zwang. Und die Türme der Hexer, die sich als Herrscher über Leben und Tod wähnten, umtost von schwarzen Wolken, schwankten. Erst jetzt begriffen sie, dass Kaledor die Wahrheit gesagt hatte, und dass das Ende von Thalas'Enara gekommen war.
Aranthir Ildanach, Hexerfürst von Thalas'Enara
In den Annalen von Thalas’Enara wird berichtet, dass in den Tagen, als das Unglück über die Stadt hereinbrach, die Erde bebte und der Himmel sich verdunkelte. Caltharnae brach auf wie ein feuriger Schlund und spieh Tod und Verderben. Eine Druckwelle giftiger Gase rollte über das Land. Glühende Lavabrocken hagelten wie Kometen auf das Land nieder und steckten die Wälder und Wiesen in Brand. Und dann regnete es Asche, dass man kaum die Hand noch vor Augen sah. Der Turm des Hexerfürsten Eldrin Ildanach, begann zu schwanken. Er rief seine Getreuen zusammen, sie wälzten Bücher, sie schleuderten Zauber hinab in den Abgrund unter der Oberfläche der Welt, denn sie ahnten, dass die Macht in der Tiefe, die ihnen ihre Gabe verlieh, entfesselt worden war und sich gegen sie wandte.
Doch so sehr sie die Ursache in ihren Taten suchten und so sehr sie dem Dunkel drohten, es verfluchten oder anflehten, sie zu verschonen, so nutzlos war ihr Trachten, denn eine Maschine kennt keine Moral. Es waren die Mächte der Tektonik, die in diesen Tagen sprachen und einen Teil der Maschinen zerstörten und eine Katastrophe auslöste, für die den Menschen ein Name fehlte. Alles, was sie sahen, glich einem gewaltigen Beben und dem Ausbruch etlicher Vulkane gleichzeitig.
Eldrin Ildanach, der Hexerfürst, stand auf der höchsten Spitze seines Turmes, umgeben von seinen Zauberbüchern und Artefakten der Macht. Doch nicht einmal seine große Weisheit konnte das Unvermeidliche abwenden. Mit einem letzten, donnernden Krachen gab der Turm nach, und der Hexerfürst fiel mit ihm in die Tiefe. Unter einem gewaltigen Tosen stürzte das höchste Gebäude von Thalas'Enara in sich zusammen. Die Steine begruben jeden, der sich mit ihm darin aufgehalten hatte. Inmitten des Unwetters hielt die ganze Stadt für einen Moment den Atem an. Als der Staub sich legte, war von Eldrin Ildanach nichts mehr übrig als eine Erinnerung, die im Wind verwehte.
Aranthir, sein Sohn, der bis dahin im Schatten seines Vaters gestanden hatte, fand sich plötzlich als Herrscher wieder, und er sollte der letzte Hexerfürst des versinkenden Kontinents sein. Die Hexer von Thalas’Enara, die einst seinem Vater die Treue geschworen hatten, wandten sich nun hilfesuchend an ihn, wartetend auf seinen Befehl. Vielleicht hofften sie, sein Vater hätte ihn mit einem geheimen Plan betraut, doch der einzige Plan, den er hatte, war von ihm selbst und von Kaledor.Aranthir wusste, was getan werden musste.
Mit einer Stimme, die das Beben der Erde übertönte, befahl er: “Die Zeit ist gekommen, die Schiffe zu besteigen, die wir vorbereitet haben. Lasst uns fliehen, denn Thalas’Enara ist verloren.”
Die Hexer, die seine Worte hörten, erkannten die Wahrheit in ihnen und eilten, um das Volk zur Flucht zu rüsten. Als die Hexer und die Gewöhnlichen zum Hafen rannten, merkte Aranthir, dass jemand Wichtiges fehlte.
Währenddessen durchsuchte Kaledor, der Hexenjäger, die Trümmer des Turmes. Um ihn herum schlugen glühende Lavabrocken ein. Die Luft biss in seinen Lungen, er hatte sich ein Tuch vor Mund und Nase gezogen, doch ihn quälte bellender Husten. Seine starken Hände, die einst das Schwert geführt hatten, rollten Stein um Stein beiseite, denn er erinnerte sich der Worte Aranthirs. Immer näher kam er dem Leuchten, bis seine Finger nach dem Zepter griffen, das unter den Steinen verborgen gelegen hatten. An dessen Spitze schimmerte der Kristall der Vorsehung, das Symbol der Macht der Hexerfürsten, das einst Eldrin Ildanach gehörte. Kaledor kam wieder auf die Beine, stolperte, als die Erde erneut bebte, und stürzte. Immer wieder musste er sich aufrappeln, um vorwärts zu kommen, während er hörte, wie Aranthir im Sturm seinen Namen schrie.
Der Kristall leuchtete wie eine Fackel in der Dunkelheit. Kaledor hob das Zepter, um etwas zu sehen und um Aranthir zu zeigen, dass er nahte, und das Licht des Kristalls brach sich in den Splittern der berstenden Fenster, als die Stadt langsam zu versinken begann.
Die Gewöhnlichen und die wenigen überlebenden Hexer standen vor den schwarzen Schiffen, die auf den Wellen bockten wie störrische Pferde. Nicht jeder wagte es, ein Schiff zu betreten, denn sie kannten nichts als Caltharnae und wussten nicht, ob es irgendwo anders Land gäbe. Manch einer blieb zurück, um gemeinsam mit Thalas'Enara zu versinken. Die anderen setzten die Segel, um dem Sturm zu trotzen. Die Winde heulten und die Wellen schlugen gegen die Kiele der Schiffe, als wollten sie sie zurück in die sterbende Stadt ziehen. Es erforderte eine hohe nautische Kunst, gegen sie anzusegeln. Ein Hexer hatte den Plan gefasst, doch es waren die Sterblichen, auf deren Künste jetzt ankam. Mit dem Mut, der aus der Verzweiflung geboren wurde, bestiegen die Menschen die Schiffe, ihre Hände fest um die Ruder geschlossen, die Segel gebläht, ihre Augen voller Tränen, die sich mit dem Regen vermischten. Sie sangen Lieder ihrer Vorfahren, um ihre Herzen zu stärken, während die Schiffe sich ihren Weg durch die Wellen brachen. Ihre Stimmen erhoben sich über das Donnern des Sturms, ein Chor des Lebens inmitten des Todes.
Hinter ihnen versank Thalas'Enara, die Türme fielen und die Mauern brachen. Lava und Meer vermischten sich zischend und brodelnd. Wer sich noch auf Caltharnae befand, wurde von den kochenden Fluten verschlungen. Und die Steine, die für die Ewigkeit gebaut wurden, verschwanden in den dunklen Tiefen des Meeres und mit ihnen all die Geräte, Artefakte und Bücher über die grausamsten Formen der Magie.
So kämpften die Menschen von Thalas'Enara gegen den Sturm, mit den schwarzen Schiffen als ihren Gefährten, und in ihren Herzen trugen sie die Hoffnung, dass sie eines Tages wieder ein Zuhause finden würden. Vor den Menschen lag die Unendlichkeit des Ozeans, ein neuer Anfang, der jenseits des Horizonts wartete. Mit jedem Ruderschlag ließen sie die Vergangenheit hinter sich. Sie segelten in eine Zukunft, über die das Zepter bisher geschwiegen hatte. Das Leuchten des Steins war verblasst, der Kristall der Vorsehung leblos wie Glas.
Als das Meer ruhiger wurde, setzte Aranthir sich erschöpft neben Kaledor, doch niemand sagte etwas. Zu tief saß der Schock und noch immer wussten sie nicht, ob sie überleben würden. Alles, was sie noch am Leben hielt, war die Hoffnung, dass irgendwo jenseits des Horizonts ein neues Zuhause auf sie warten würde.
Schwarzer Regen
Nach dem Aschefall kam der schwarze Regen, und wenngleich er leise und für angenehm kühl über die staubige Haut rann, lauerte in ihm ein noch größeres Verderben.
[...]
 Aus der Einleitung des Codex Vindici
Aus der Einleitung des Codex Vindici Produkte der Nahlfarnis
Produkte der Nahlfarnis
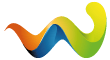

 Die Sturmwächter
Die Sturmwächter
